Die wissenschaftliche und gesellschaftliche Bedeutung der biologischen Geschlechtsunterschiede wurde in den letzten Jahrzehnten weitgehend übersehen. Frauen waren und sind in der präklinischen Forschung, bei klinischen Arzneimittelprüfungen und in der Arzneimittelentwicklung unterrepräsentiert. Ein wichtiger Grund für die Intensivierung der Forschung zur geschlechtsspezifischen Biologie ist die ungleiche Prävalenz, der Beginn und das Fortschreiten vieler Krankheiten, einschließlich neurologischer Störungen. So treten einige Krankheiten wie Autismus-Spektrum-Störungen und die Parkinson-Krankheit häufiger bei Männern auf, während andere wie schwere depressive Störungen, Alzheimer und Multiple Sklerose eher bei Frauen vorkommen.
Die Geschlechtsunterschiede im menschlichen Gehirn sind ein komplexes und wichtiges Forschungsgebiet mit tiefgreifenden Auswirkungen auf Gesundheit und Krankheit. Die Vermännlichung des Gehirns wird durch einen Anstieg der männlichen Gonadenhormone während der Neugeborenenzeit eingeleitet, die die langfristige Gehirnstruktur durch die Organisation neuronaler Schaltkreise prägen, die später nach der Pubertät die sexuellen Funktionen unterstützen.
Diese geschlechtsspezifischen Unterschiede entstehen wahrscheinlich durch ein komplexes Zusammenspiel von (epi-)genetischer und hormoneller Regulierung sowohl in Neuronen als auch in Gliazellen. Während sich die Forschung traditionell auf Neuronen konzentriert hat, ist der Geschlechtsdimorphismus von Gliazellen noch relativ wenig erforscht, obwohl sie eine wesentliche Rolle für das Überleben und die Funktionalität von Neuronen sowie für die Homöostase ihrer Aktivität spielen.
Um ein tieferes Verständnis der geschlechtsspezifischen Unterschiede im Gehirn bei Gesundheit und Krankheit zu erlangen, ist es von entscheidender Bedeutung, die Entwicklung und Funktion von Gliazellen sowohl im weiblichen als auch im männlichen Gehirn gründlich zu untersuchen. Obwohl inzwischen immer mehr Forschungsprojekte beide Geschlechter einbeziehen, fehlt es immer noch an einem systematischen Ansatz zur Untersuchung von Geschlechtsunterschieden in den Neurowissenschaften.
Das Programm SPP 2561 SEX and GLIA will diese Lücke mit zwei Hauptzielen schließen:
- Das Verständnis geschlechtsspezifischer Mechanismen in der Glia-Biologie: Aufdeckung grundlegender Mechanismen an der Schnittstelle von Genetik und hormonellen Einflüssen, mit Schwerpunkt auf physiologischer, transkriptioneller und epigenetischer Regulierung.
- Entschlüsselung der funktionellen Konsequenzen der geschlechtsspezifischen Glia-Biologie: Es soll ermittelt werden, wie sich genetische und hormonelle Unterschiede zwischen Männern und Frauen auf die Funktion von Gliazellen auswirken - idealerweise auf der Ebene der einzelnen Zelle oder des Zelltyps - und wie molekulare Veränderungen mit zellulären Phänotypen verknüpft werden können, um so transkriptionelle und epigenetische Veränderungen zu identifizieren, die zu Krankheiten beitragen.
Daher zielt das SPP 2561 darauf ab, Fachwissen in den Bereichen Glia-Biologie, funktionelle Genomik und Computerbiologie zu bündeln, um Projekte zu fördern, die wichtige Fortschritte beim Verständnis der geschlechtsspezifischen Rolle von Gliazellen und ihrer Wechselwirkung mit Neuronen und letztlich der Entstehung von Krankheiten ermöglichen.
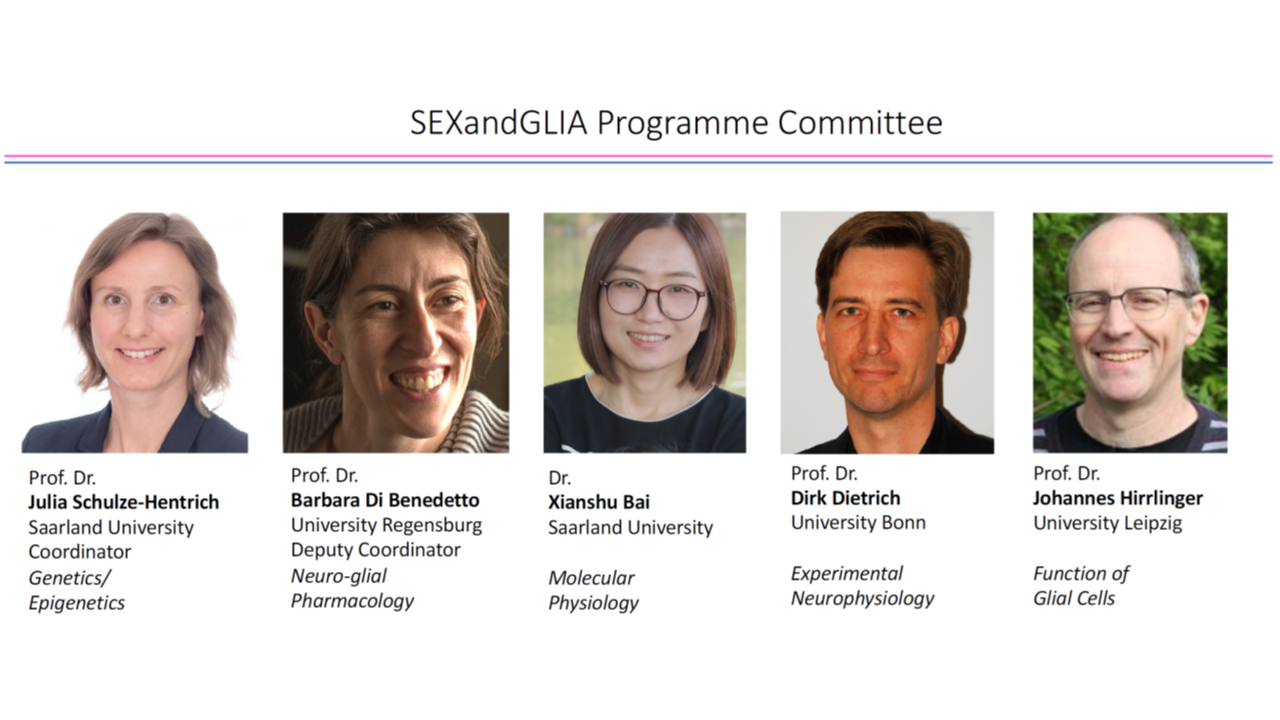

Gefördert durch die Deutsche Forschungsgemeinschaft
1.Förderperiode: 2026-2029
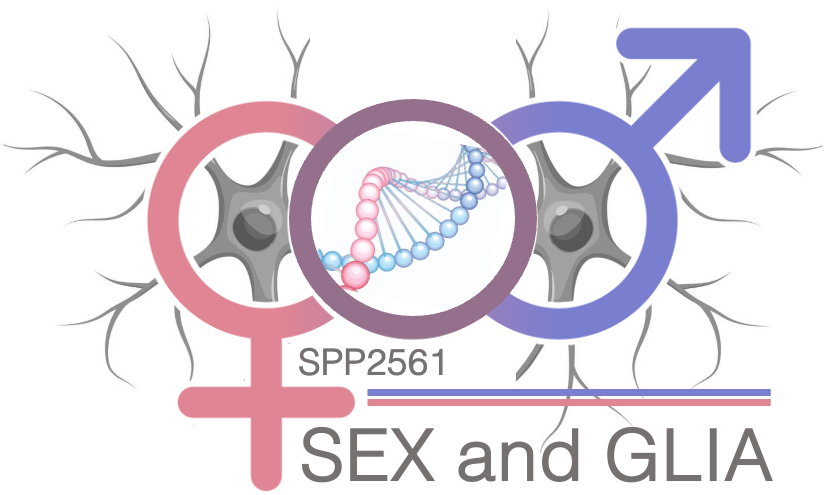
Aktueller Status
In den kommenden Monaten werden die Schwerpunktprogramme einzeln von der DFG ausgeschrieben, um interessierte Wissenschaftler*innen aufzufordern, in den Verbünden mitzuarbeiten. Die eingehenden Förderanträge prüft die DFG auf ihre wissenschaftliche Qualität und ihren Beitrag zum jeweiligen Hauptthema. Insgesamt werden Schwerpunktprogramme sechs Jahre lang gefördert.

