Forschungsprojekte im Bereich BioMed

In den zahlreichen Drittmittelprojekten im Schwerpunkt „BioMed – Leben und Materie“ forschen die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler der UdS zu wichtigen Fragen aus den Bereichen Medizin, Physik, Biologie und Chemie.
Im Folgenden haben wir für Sie eine Auswahl der aktuell laufenden Forschungsprojekte im Bereich BioMed zusammengestellt, die von der DFG, der Europäischen Kommission oder dem Bundesministerium für Forschung, Technologie und Raumfahrt gefördert werden.

Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG)
Im Schwerpunkt BioMed sind zwei Sonderforschungsbereiche / Transregios (SFB/TRR), bei denen mehrere Hochschulen eng zusammenarbeiten, angesiedelt. Daneben fördert die Deutsche Forschungsgemeinschaft eine Forschungsgruppe im Schwerpunktbereich.
Sonderforschungsbereiche (SFB)
- Fachliche Zuordnung: Medizin
- Projektleitung: Prof. Dr. Ulrich Boehm (Experimentelle und Klinische Pharmakologie und Toxikologie)
- Förderzeitraum: 2014-2026
- Sprecherhochschule: LMU München
Transient receptor potential (TRP)-Kanäle sind eine große Proteinfamilie mit zentralen Rollen als vielseitige zelluläre Sensoren und Effektoren. TRP-Proteine steuern ein außergewöhnlich breites Spektrum homöostatischer physiologischer Funktionen: Mehr als zwanzig menschliche Erbkrankheiten werden durch Mutationen in zwölf TRP-Genen hervorgerufen. Die meisten TRP-Kanal-Erkrankungen wirken sich auf Entwicklung, Metabolismus und andere homöostatische Körperfunktionen aus. Ein detailliertes Verständnis der zugrunde liegenden Pathophysiologie fehlt jedoch. Der Sonderforschungsbereich konzentriert sich daher auf die Physiologie und Pathophysiologie von TRP-Ionenkanälen. Entwickelt werden neue molekulare Werkzeuge und Techniken zur Analyse von TRP-Kanalfunktionen. Dies soll spezifische und maßgeschneiderte Therapieoptionen für Patienten möglich machen, deren Erkrankungen durch dysfunktionelle TRP-Proteine mitverursacht werden.
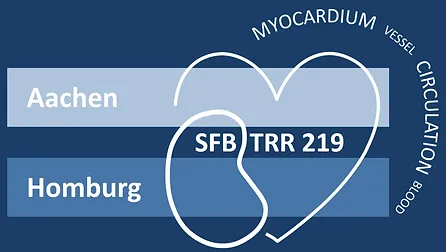
- Fachliche Zuordnung: Medizin, Biologie
- Projektleitung: Prof. Dr. Danilo Fliser (Nieren- und Hochdruckkrankheiten)
- Förderzeitraum: 2018-2029
- Fördersumme: 14 Mio. € (für die dritte Förderperiod 2026-2029)
- Sprecherhochschule: RWTH Aachen
Ziel des Transregio-Sonderforschungsbereichs TRR219 ist es, in experimentellen und klinischen Studien die multifaktoriellen Aspekte der chronischen Nierenerkrankung bedingten kardiovaskulären Morbidität und Mortalität zu analysieren, die durch Veränderungen des Kreislaufs und des Herzmuskels verursacht werden. Neben der Untersuchung pathologischer Mechanismen, die das kardiovaskuläre System bei CKD betreffen, auf grundlagenwissenschaftlicher Ebene werden wir auch die translationalen Aspekte untersuchen, indem wir neuartige Interventionen und diagnostische Tests im Zusammenhang mit der CKD-bedingten kardiovaskulären Pathologie analysieren.
Weitere DFG-geförderte Projekte
- Forschungsgruppe
- Fachliche Zuordnung: Wärmetechnik / Verfahrenstechnik
- Sprecher: Prof. Dr. Christian Wagner (Experimentalphysik)
- Förderzeitraum: seit 2019
Die Art und Weise, wie Blut durch die Gefäße strömt, spielt eine wesentliche Rolle bei der Entstehung von Herz-Kreislauf-Erkrankungen, etwa Thrombosen und Arteriosklerose. Allerdings sind die physikalischen Grundlagen des Blutstroms kaum bekannt. Blut ist heterogener als Wasser ist und wird von einer Pumpe, dem Herzen, angetrieben, es pulsiert. Bisherige Experimente zum Strömungsverhalten basieren aber in der Regel auf Wasser, das sich gleichförmig bewegt. Ein interdisziplinäres Team aus der Physik, den Ingenieurwissenschaften und der Medizin aus mehreren Universitäten wollen diese Wissenslücke schließen. Gemeinsam arbeiten sie in der neu eingerichteten Forschungsgruppe „Instabilitäten, Bifurkationen und Migration in pulsierender Strömung“ an diesem Ziel.
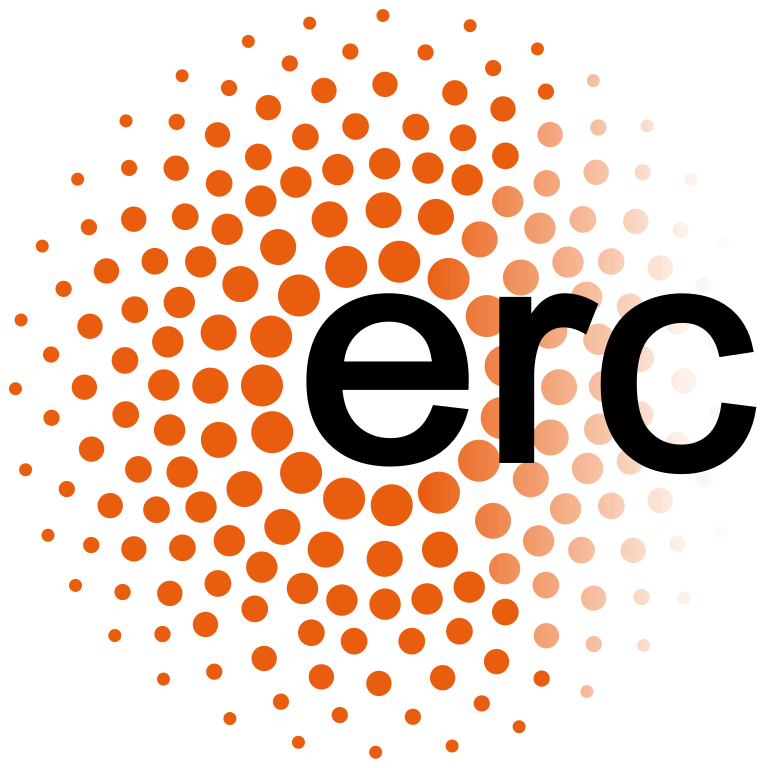
Europäische Kommission
Die folgenden Forschungsprojekte im Schwerpunkt BioMed werden durch die Europäische Kommission gefördert und von der Universität des Saarlandes koordiniert. Hierzu zählen auch die verschiedenen Förderungen des Europäischen Forschungsrats (European Research Council, ERC).
Europäischer Forschungsrat (ERCs)

- Horizon 2020 – ERC Synergy Grant
- Projektleitung: Prof. Dr. Jens Rettig (Zelluäre Neurophysiologie)
- Förderzeitraum: 2021-2027
Zytotoxische T-Lymphozyten (CTL) produzieren zytotoxische Proteinkomplexe bzw. supramolekulare Angriffspartikel (SMAP), die infizierte Zellen und Krebszellen eliminieren. Supramolekulare Angriffspartikel bestehen aus einer äußeren Kernstruktur und bilden sich in den sekretorischen Granula zytotoxischer T-Lymphozyten.
Im EU-finanzierten Projekt ATTACK analysieren Spitzenforschende aus dem Bereich Immunologie im Detail die Erzeugung von SMAP sowie deren Wirkungsweise und Eliminierung von Krebszellen. Auf dieser Basis sollen dann natürliche SMAP isoliert oder SMAP synthetisch und unabhängig von zytotoxischen T-Lymphozyten erzeugt werden, um daraus Krebsmedikamente zu entwickeln. Der vorgeschlagene Ansatz kann allein oder in Kombination mit biotechnologischen T-Zellen zum Einsatz kommen.
- Horizon Europe – ERC Starting Grant
- Projektleitung: Jun.-Prof. Dr. Laura Aradilla Zapata (Molekulare Zellbiophysik)
- Förderzeitraum: 2024-2027
Menschliche Zellen sind Wunderwerke der Natur: Sie können sich zum Beispiel durch enge Poren quetschen, sind gleichzeitig aber sehr stabil. Eine wichtige Rolle hierbei spielen zwei Bestandteile des Zellskeletts, starre Mikrotubuli und flexible Intermediärfilamente. Wie diese beiden Komponenten miteinander interagieren, ist bisher wenig erforscht. Laura Aradilla Zapata erhält dafür ab 2024 1,5 Millionen Euro im Rahmen eines ERC Starting Grants.
- Horizon Europe – ERC Starting Grant
- Projektleitung: Prof. Dr. Thorsten Keßler (Kardiologie)
- Förderzeitraum: 2023-2027
Thorsten Kessler erforscht im Projekt MATRICARD einen bislang wenig beachteten Faktor bei Herzinfarkt und koronarer Herzkrankheit: die extrazelluläre Matrix (EZM). Dieses Gerüst, in dem unsere Zellen eingebettet sind, ist weit mehr als nur eine Stützstruktur.
Während sich die Forschung traditionell auf Herzmuskel-, Gefäß- und Blutzellen konzentriert, rückt das Projekt MATRICARD die EZM in den Mittelpunkt. Neuere Erkenntnisse zeigen, dass sie eine zentrale Rolle in der Zellkommunikation spielt. Kesslers Team konnte bereits nachweisen, dass Proteine in der EZM das Verhalten benachbarter Zellen beeinflussen – etwa bei Entzündungsreaktionen.
Mit dem ERC Starting Grant analysieren die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler nun die molekularen Mechanismen in der EZM im Detail. Ziel ist es, neue Ansatzpunkte für Therapien gegen Herz- und Gefäßerkrankungen zu identifizieren.
- Horizon Europe - ERC Consolidator Grant
- Projektleitung: Prof. Dr. Tsing-Young Dora Tang (Synthetische Biologie)
- Förderzeitraum: 2023-2028
Eine große Herausforderung in der synthetischen Bottom-up-Biologie besteht darin, synthetische Zellen mit lebensähnlichen Eigenschaften aus einer minimalen Anzahl von Teilen zu entwerfen und zu konstruieren. Die Verwirklichung dieses Ziels wäre eine große technische Leistung und würde ein Verständnis dafür ermöglichen, wie lebende Systeme aus der Perspektive der physikalischen Chemie funktionieren. Um dies zu erreichen, haben wir uns Bottom-up-Ansätze zunutze gemacht und neue Erkenntnisse über die Auswirkungen der Kompartimentierung auf die Thermodynamik und Kinetik eingebauter Enzymreaktionen gewonnen. Unsere Erkenntnisse, dass eine dynamische Koazervierung ruhende Enzymreaktionen in Gang setzen kann, bilden den konzeptionellen Rahmen für unseren Plan, synthetische zelluläre Systeme zu entwickeln, die dauerhaft außerhalb des Gleichgewichts stehen. Die Ziele von MinSyn sind:
- Definieren, wie molekulare Reaktionsnetzwerke durch Kompartimentierung abgestimmt werden.
- Aufbau minimaler synthetischer Kompartimente mit selbsterhaltendem, aus dem Gleichgewicht geratenem Verhalten.
- Nutzung der Kommunikation zur Koordinierung von Reaktionsnetzwerken innerhalb von Zellpopulationen.
Zusammengenommen testen diese Ziele unsere übergreifende Hypothese, dass nachhaltige Systeme außerhalb des Gleichgewichts durch die Verknüpfung von drei Merkmalen geschaffen werden können: molekulare Reaktionsnetzwerke, Kompartimentierung und Kommunikation. Der Schlüssel zu diesem Unterfangen ist unsere einzigartige Kombination von chemischen, biochemischen und biophysikalischen Werkzeugen für die quantitative Charakterisierung synthetischer zellulärer Systeme. Wir sind in der Lage, die große technische Herausforderung des Aufbaus dauerhafter synthetischer Zellsysteme außerhalb des Gleichgewichts zu bewältigen und ein zentrales Problem der Biowissenschaften anzugehen: "Wie erhalten biologische Zellen und Gewebe Leben aus Ansammlungen von nicht lebenden Molekülen?" Unser interdisziplinärer Ansatz wird der Gemeinschaft neue Werkzeuge zur Verfügung stellen und stellt einen einzigartigen multidisziplinären Ansatz dar, der letztendlich die chemisch-physikalischen Parameter des Lebens definieren wird. Dies kann zu noch nie dagewesenen Möglichkeiten der rationellen Entwicklung molekularer Systeme führen, die die biologischen Fähigkeiten übertreffen könnten.
- Horizon Europe - ERC Starting Grant
- Projektleitung: Prof. Dr. Dominik Munz (Allgemeine und anorganische Chemie)
- Förderzeitraum: 2020 bis 2026
Das gezielte Moleküldesign ermöglicht die Entwicklung neuartiger Solarzellen, Batterien oder Medikamente. Problematisch ist bisher jedoch noch häufig die Spaltung sogenannter „starker Bindungen“. Diese sind jedoch essentiell für Energieumwandlungs- und Energiespeicherungsprozesse, wie sie eben in Solarzellen und Batterien ablaufen. Das EU-Projekt PUSH-IT entwickelt einen neuartigen und allgemeinen Ansatz zur schonenden und potentiell nachhaltigen Veredelung dieser Bindungen und möchte Ladungstrennung als universelles Prinzip in der Synthesechemie etablieren.
Weitere EU-geförderte Projekte

- Horizon Europe - The European Innovation Council (EIC)
- Projektleitung: Prof. Ralf Busch (Lehrstuhl für Metallische Werkstoffe)
- Förderzeitraum: März 2022 bis Februar 2026
Additive Fertigung könnte sich bald als Standardverfahren für die Herstellung von weichmagnetischen Komponenten für hocheffiziente elektrische Maschinen sowie für passive elektrische Systeme etablieren. Aufgrund ihrer exzellenten mechanischen sowie magnetischen Eigenschaften eignen sich metallische Gläser für die Realisierung von hocheffizienten, 3D-gedruckten elektrischen Motoren. Das von der EU geförderte Projekt AM2SoftMag wird metallische Glass-Legierungen entwerfen und -Pulvern entwickeln für das auf selektives Lasersintern (SLM) basierte Verfahren zur additiven Fertigung von weichmagnetischen Komponenten für elektrische Maschinen. Vom Design amorpher weichmagnetischer Pulverlegierungen über die Optimierung SLM-Druckparameter bis hin zur Verifizierung der resultierenden elektromagnetischen Systeme, AM2SoftMag wird das technologische Potenzial elektrischer Motoren und ihre Anwendung in Assistenzgeräte sowie für e-Mobilität bedeutsam erhöhen.
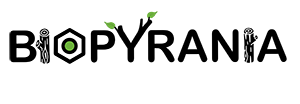
Biopyrania - Biobased Pyrazine Monomers From Second Generation Biomass For High Performance Polymers, Copolymers And Blends
- Horizon Europe
- Projektbeteiligte an der UdS: Prof. Dr. Christoph Wittmann (Institut für Systembiotechnologie)
- Förderzeitraum: 2024-2028
Die Initiative für nachhaltige Produkte (SPI) in Europa zielt darauf ab, die Entwicklung und Markteinführung nachhaltigerer, wiederverwertbarer und langlebiger Produkte zu fördern, wobei der Schwerpunkt auf Elektronik, Textilien, Möbeln, Stahl, Zement und Chemikalien liegt.
Das Projekt BIOPYRANIA nimmt sich dieser Herausforderung an und stellt einen bahnbrechenden Ansatz vor, indem es innovative biobasierte Verbindungen entwickelt - insbesondere Bausteine auf Pyrazinbasis, die sicher und nachhaltig durch synthetisierte Säuren aus holzartiger Biomasse der zweiten Generation hergestellt werden - mit dem Potenzial, Hochleistungsanwendungen in den Bereichen Automobil und grüner Wasserstoff zu revolutionieren.
An dem Projekt ist ein Konsortium aus akademischen Einrichtungen, Forschungsorganisationen und innovativen Unternehmen beteiligt.

REPurpose – Repurposing post-consumer waste into recyclable rubbery plastics
- Horizon Europe
- Projektbeteiligte an der UdS: Prof. Dr. Christoph Wittmann (Institut für Systembiotechnologie)
- Förderzeitraum: 2022-2026
REPurpose integriert das SSbD-Konzept, um die weltweit ersten unendlich wiederverwertbaren und zusatzstofffreien gummiartigen Materialien, die auf Kunststoffabfällen basieren und mit Biokohlenstoff integriert sind, um Eigenschaften für ein breites Spektrum von Anwendungen zu optimieren, die neue neue Maßstäbe in Bezug auf Kosten, Funktion und Ökologie. Fortschrittliches Polymer-Grundgerüstdesign verleiht REP-Polymeren einzigartige Eigenschaften wie biologische Abbaubarkeit und unendliche Wiederverwertbarkeit durch enzymatisches Recycling.
Die jährliche Kunststoffproduktion beläuft sich auf nahezu 380 Millionen Tonnen und wird sich bis 2035 voraussichtlich verdoppeln verdoppeln und sich bis 2050 sogar vervierfachen, was die Suche nach neuen Lösungen zur hochwertiges Recycling zu steigern. Um dieses Ziel zu erreichen, sollte jedes Produkt sollte jedes Produkt auf dem Konzept der Sicherheit und Nachhaltigkeit durch Design basieren um Sicherheit, Kreislaufwirtschaft und Funktionalität von der ersten Designphase bis zum Ende des Lebenszyklus.

- Horizon Europe – Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA)
- Förderzeitraum: 2023–2027
TALENTS zielt darauf ab, ein internationales Programm für die interdisziplinäre und sektorübergreifende Ausbildung von 15 Doktorandinnen und Doktoranden aufzubauen, die für die nächste Generation von Arzneimittelforschern benötigt werden. Im Rahmen von 15 einzelnen, aber miteinander verbundenen Forschungsprojekten wollen wir Krankheitsmodelle, Analysemethoden und mikrobiombezogene Ergebnisse entwickeln und austauschen. Durch die Gewinnung von Erkenntnissen über Korrelationen und Kausalitäten zwischen Mikrobiota und Krankheit wird TALENTS die Entwicklung neuartiger mikrobiom-modulierender Therapien vorantreiben.
TALENTS baut auf einem früheren gemeinsamen Projekt der Universität des Saarlandes, des Universitätsklinikums des Saarlandes und des Helmholtz-Instituts für Pharmazeutische Forschung Saarland auf, um die transdisziplinäre Doktorandenausbildung zwischen verschiedenen Fakultäten und Institutionen zu fördern. Überdies ist TALENTS sektorübergreifend, indem es eine einzigartige Betreuungsstruktur für jede Doktorandin und jeden Doktoranden mit einem externen Expertenberater und eine translationsorientierte Ausbildung für die individuelle Karriereentwicklung einführt, die auch Abordnungen in einen komplementären industriellen oder klinischen Sektor umfasst. Durch die Arbeit an anspruchsvollen Forschungsprojekten werden die Kandidatinnen und Kandidaten spezifische Kenntnisse und Fähigkeiten an der Schnittstelle von klinischer Medizin, Mikrobiologie und pharmazeutischer Wissenschaft erwerben, die für die moderne Infektionsforschung und Mikrobiom-Interventionen von zentraler Bedeutung sind.
Durch die Zusammenarbeit von Experten aus den Naturwissenschaften, der Medizin und der Bioinformatik bietet TALENTS eine multidisziplinäre und sektorübergreifende Ausbildung auf hohem Niveau.
Zudem ist die UdS an diesen von der Europäischen Kommission geförderten Projekten als Teilnehmerin beteiligt:
- EPIVINF – Epigenetic regulation of host factors in viral infections (2022-2027)
- ETERNAL – Boosting the reduction of the environmental impact of pharmaceutical products throughout their entire life cycle (2022-2026)
- HORUS – Casting light on HOst-cytomegaloviRUs interaction in Solid organ transplantation (2022-2027)
- LiverScreen – Screening for liver fibrosis - population-based study across European countries (2020-2025)
- SINPAIN – A game changer for the treatment of osteoarthritis: a cost effective combined advanced therapy to treat knee osteoarthritis (2022-2026)
Bundesministerium für Forschung, Technologie und Raumfahrt
Die folgenden Forschungsprojekte im Schwerpunkt BioMed werden aktuell durch das Bundesministerium für Forschung, Technologie und Raumfahrt (BMFTR) gefördert.
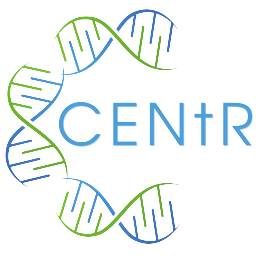
- Projektleitung: Prof. Dr. Andriy Luzhetskyy (Professur für Pharmazeutische Biotechnologie)
- Förderzeitraum: 2024-2028
Antibiotikaresistenzen zählen zu den größten Bedrohungen für die globale Gesundheit. Das Deutsch-Ukrainische Exzellenzzentrum für Naturstoffforschung (CENtR) mit Sitz in Lwiw, Ukraine, wurde gegründet, um dieser Herausforderung zu begegnen.
Die Universität des Saarlandes ist als einer der vier Hauptpartner an diesem vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) geförderten Projekt beteiligt. Gemeinsam mit dem Helmholtz-Institut für Pharmazeutische Forschung Saarland (HIPS), der ukrainischen Firma Explogen und der Iwan-Franko-Universität Lwiw erforscht CENtR neue antibiotische Wirkstoffe aus mikrobiellen Quellen.
Die Forschenden nutzen moderne Genomanalyse und synthetische Biologie, um bislang unentdeckte Naturstoffe aus Actinobakterien zu identifizieren. Durch die gezielte Analyse genetischer Baupläne können vielversprechende Wirkstoffkandidaten für die Antibiotikaentwicklung gewonnen werden.
Neben der Grundlagenforschung unterstützt CENtR aktiv die ukrainische Wissenschaftslandschaft. In Kooperation mit dem Superhumans Center in Lwiw analysiert das Team multiresistente Bakterien aus Wunden verletzter ukrainischer Soldaten, um Behandlungsstrategien zu verbessern.
- Projektleitung: Prof. Dr. Christoph Wittmann (Systembiotechnologie)
- Förderzeitraum: 2024-2026
Mit dem Projekt FUMBIO adressieren wir den steigenden Bedarf an biobasierten chemischen Produkten mit gutem Ökoprofil durch die Entwicklung einer neuen, nachhaltigen "Fumarat-Wertschöpfungskette".
Basierend auf Fermentation soll diese die chemische Synthese von Fumarat aus fossilen Rohstoffen ersetzen. Das neue Verfahren verwendet dabei zwei Hauptausgangsstoffe: CO2, das aus chemischen Prozessen gewonnen wird, und Zucker (z. B. Glukose), der von Pflanzen wiederum aus CO2 erzeugt wird. So ist der zu erwartende CO₂-Fußabdruck von Fumarat und weiteren nachgelagerten Produkten im Vergleich zu den auf Petrochemie basierenden Standardverfahren deutlich geringer oder sogar negativ. Des Weiteren werden wir biokatalytische Wege entwickeln, um das Fermentations-basierte Fumarat weiter zur Herstellung von biologisch abbaubaren Chemikalien einzusetzen, wie z. B. Komplexbildnern und Polymeren. Beides sind großvolumige Produktgruppen (>200 kt/Jahr), so dass hier ein bedeutendes Potential zur Nachhaltigkeitsverbesserung erzeugt wird.
Mit FUMBIO wollen wir die komplette Wertschöpfungskette von den Rohstoffen bis zum Endprodukt aufzeigen sowie die Umweltauswirkungen und den CO2-Fußabdruck im Rahmen einer Lebenszyklusanalyse bewerten. Das Konsortium aus Experten aus den Bereichen Metabolic Engineering, Systembiotechnologie, Biochemie, Bioprozessentwicklung und Lebenszyklusanalyse (Philipps-Universität Marburg, Universität des Saarlandes, Rheinland-Pfälzische Technische Universität Kaiserslautern-Landau, BASF) verfügt über alle erforderlichen Werkzeuge und Know-how zur Erreichung der skizzierten Ziele. Wir erwarten kurze Entwicklungszeiten, eine hohe technische Erfolgswahrscheinlichkeit trotz signifikanter Notwendigkeit zur Innovation, Wettbewerbsfähigkeit und hohe Nachhaltigkeit als Basis für die erfolgreiche kommerzielle Umsetzung.
- Projektleitung: Prof. Dr. Christoph Becher (AG Quantenoptik)
- Förderzeitraum: 2025–2027
Quantenkommunikation ist eine Schlüsseltechnologie für zukünftige Sicherheit in der Datenübertragung. Sie kann sowohl vor Attacken mittels moderner Computer als auch durch leistungsstarke Quantencomputer schützen. Dies wird möglich, da fundamentale physikalische Prinzipien die Sicherheit ausgetauschter Schlüssel garantieren. Für eine quantengesicherte Kommunikation über längere Distanzen werden sogenannte Quantenrepeater gebraucht. Diese können Quantenzustände sicher speichern und weiterverteilen.
Im Projekt "QR.N" planen die Verbundpartner, erstmalig Quantenrepeater-Strecken mit mehr als zwei Knoten zu demonstrieren und parallele Quantenkanäle unter Verwendung von Multiplexing einzurichten. Dazu entwickeln die Forschenden nicht nur Basiskomponenten für Quantenrepeater weiter, sondern erforschen auch deren Einsatz auf Teststrecken außerhalb universitärer Labore. Es soll ein Quantenvorteil bei der Übertragung erzielt und Fehlerkorrektur für leistungsstarke Quantenrepeater implementiert werden. Die im Projekt entwickelte Hardware basiert auf verschiedenen physikalischen Systemen: Atomen und Ionen, Halbleiter-Quantenpunkten und Farbzentren in Diamant. Diese werden um weitere Systeme für Quantenspeicher, beispielsweise Selten-Erd-Ionen ergänzt. Durch eine hybride Kombination der Hardware-Systeme und mit dem Einsatz systemübergreifender Protokolle sollen hardware-unabhängige Quantenrepeater entwickelt werden.
Quantenrepeater sind eine wesentliche Schlüsselkomponente für künftige Quantennetzwerke. Mögliche Anwendungsfelder liegen zunächst in der quantensicheren Kommunikation, beispielsweise beim Schutz kritischer Infrastrukturen oder in der Behördenkommunikation. Perspektivisch können Quantenrepeater langreichweitige Quantennetze mit verschränkten Quantenzuständen ermöglichen bis hin zu europaweiten Dimensionen mit vielfältigen neuartigen Einsatzbereichen wie beispielsweise verteiltem Quantenrechnen.
- Projektleitung: Prof. Dr. Christoph Wittmann (Institut für Systembiotechnologie)
- Förderzeitraum: 2025-2027
Antibiotika schützen in einzigartiger Weise vor Infektionen. Die kostengünstige und umweltverträgliche Bereitstellung dieser Substanzen bietet daher breite Nutzungsmöglichkeiten. Vor diesem Hintergrund soll ein biobasiertes Verfahren zur nachhaltigen Produktion des industriell bedeutenden Antibiotikums Oxytetrazyklin (OTC) entwickelt werden. Unter Nutzung des Bodenbakteriums Streptomyces albus sollen mittels moderner Methoden der Synthetischen Biologie und Systembiotechnologie maßgeschneiderte Zellfabriken mit einem breiten Substratspektrum und hoher OTC-Syntheseleistung erzeugt werden. Durch Integration mit verfahrenstechnischer Prozessentwicklung wird die komplette Wertschöpfungskette von Agrarreststoffen bis zum fertigen Produkt abgedeckt. Die Machbarkeit des Verfahrens wird im Pilotmaßstab demonstriert und für die Darstellung von OTC in pharmazeutischer Qualität genutzt. Das Projekt schafft zudem eine innovative Plattformtechnologie für die nachhaltige Antibiotikaproduktion. Durch die Umwandlung von landwirtschaftlichen Abfällen in hochwertige Pharmazeutika werden im Projekt effektiv ökologische und wirtschaftliche Herausforderungen adressiert.
- Projektleiter: Christoph Becher (Quantenoptik)
- Förderzeitraum: 2023–2026
Ziel des Projekts „Miniaturisierte Verschränkunsquelle im Telekombereich auf Basis von AlGaAs-Bragg-Reflexions-Wellenleitern (VOMBAT)“ ist es, eine Quelle für verschränkte Photonenpaare zu entwickeln, bei der die benötigte Pumpquelle und die Erzeugung der verschränkten Photonenpaare in einem Chip integriert sind. Für die Erzeugung von Photonen mit Frequenzen, die den verlustarmen Telekommunikation entsprechen, wird eine Photonenpaarquelle auf der Basis des Materialsystems AlGaAs entwickelt und gefertigt. Für die Verteilung der Photonenpaare auf die verschiedenen Empfänger oder Frequenzen, wird erforscht, wie dies möglichst kompakt in einer integrierten photonischen Schaltung erfolgen kann, in welche die chipintegrierte Photonenpaarquelle eingebettet ist. Auch die technologischen Voraussetzungen für eine spätere kommerzielle Verwertung werden untersucht. Das Gesamtsystem wird in einer bestehenden Glasfaserstrecke getestet.
Die Projektkoordination hat das Fraunhofer-Institut für Nachrichtentechnik inne. Neben der Universität des Saarlandes arbeiten in dem Verbundvorhaben noch zwei weitere Partner.
Sonstige Förderer
- Drittmittelgeber: Volkswagen Stiftung
- Projektleitung: Prof. Dr. Sigrun Smola (Institut für Virologie)
- Projektbeteiligte:
- Prof. Dr. Jörn Walter (Genetik und Epigenetik)
- Prof. Dr. Rolf Müller (Helmholtz-Institut für Pharmazeutische Forschung Saarland (HIPS))
- Förderzeitraum: 2023–2026
Die Reaktivierung einer latenten Virusinfektion stellt eine erhebliche Gefahr für immunsupprimierte Patienten in der Transplantationsmedizin dar. Das BK-Polyomavirus (BKPyV) ist ein noch wenig erforschtes Virus, das bei einer erheblichen Zahl von Empfängern von Nieren- oder allogenen hämatopoetischen Stammzelltransplantaten Nephropathie oder hämorrhagische Zystitis verursacht. Derzeit gibt es keinen Impfstoff, und es werden dringend Medikamente für eine präventive Behandlung benötigt, um Organschäden zu verhindern. Dieses interdisziplinäre Projekt befasst sich mit den größten Herausforderungen, die die Entwicklung von Medikamenten gegen BKPyV bisher behindert haben. Das Projektteam kombiniert auf synergetische Weise spezifisches Fachwissen in der Immun- und Zellbiologie von kleinen DNA-Viren, modernste Genomik und translationale Arzneimittelforschung, um Arzneimittelkandidaten aus einzigartigen Substanzbibliotheken zu identifizieren, die virale Schlüsselprozesse stören. Das Team hat einen neuartigen BKPyV-Replikationstest für das Wirkstoffscreening entwickelt und wird für die präklinische Validierung komplexe humane 3D-Kulturmodelle verwenden, z. B. BKPyV-infizierte Organoide der proximalen Nierentubuli, organotypische 3D-Kulturen mit integrierten Immunzellen und Organ-on-a-Chip-Modelle. Um molekulare Einblicke in die Entwicklung von Arzneimittelresistenzen zu gewinnen und Gegenstrategien zu entwickeln, werden die Forscher innovative BKPyV-spezifische Sequenzierungstechnologien der nächsten Generation einsetzen, um die genetische Anpassung des Virus und die Evolution im Wirt zu überwachen. Mit diesen kombinierten Ansätzen will das Team sowohl einen unkomplizierten translationalen Ansatz für das Repurposing von Medikamenten bei Transplantationspatienten als auch die Entwicklung völlig neuer Medikamentenklassen gegen BKPyV vorantreiben.
- Drittmittelgeber: Wilhelm Sander Stiftung
- Projektleitung: Prof. Dr. Markus Hoth (Biophysik)
- Förderzeitraum: 2024-2026
Die Erstlinientherapie des diffusen großzelligen B-Zell-Lymphoms (DLBCL) ist eine kombinierte Verabreichung verschiedener Antikörper und einer Polychemotherapie (R-CHOP, Pola-R-CHP). Natürliche Killerzellen (NK) spielen eine Schlüsselrolle als Hauptvermittler der Rituximab (R)-vermittelten Zytotoxizität. Die zytotoxische Effizienz von NK-Zellen hängt von intrazellulären Kalziumsignalen ab, die durch Orai/CRAC-Kalziumkanäle vermittelt werden.
Wir haben ein Kalzium-Optimum für die Zytotoxizität gefunden, wobei niedrigere und interessanterweise auch höhere Kalziumsignale weniger effizient sind. Um die Kalziumsignale und die zytotoxische Effizienz einzelner NK-Zellen während der apoptotischen oder nekrotischen Abtötung einzelner Lymphomzellen parallel zu analysieren, haben wir Einzelzell-Zytotoxizitätstests mit hoher Auflösung und automatisierter Analyse entwickelt.
Unser Projekt zielt darauf ab, zu analysieren, ob und wie die Kalzium-Signalübertragung in NK-Zellen die Effizienz der seriellen Abtötung von Lymphomzellen in Gegenwart von R-CHOP oder Pola-R-CHP beeinflusst. Wir wollen verstehen, ob eine gezielte Modulation der Kalzium-Signalübertragung in NK-Zellen, z. B. durch Orai-Kanalblocker, einen therapeutischen Vorteil für die Behandlung von DLBCL haben könnte und ob Kalziumkanäle und Kalzium-Signalübertragung ein Target für die Lymphomtherapie darstellen könnten.
