Forschungsprojekte und Institute

Akademieprojekt LEI
Zielsetzung des Lessico Etimologico Italiano (LEI) sind die Dokumentation und die historische Analyse des gesamten italienischen Wortschatzes von den Anfängen bis heute. Neben der italienischen Standardsprache finden dabei auch der Wortschatz der medizinischen, technischen und sonstigen Fachsprachen, die italienische Umgangssprache sowie die zahlreichen Dialekte Berücksichtigung. Mit dieser Konzeption leistet das LEI einen zentralen Beitrag zur Kenntnis der italienischen Sprachgeschichte und zur Wahrung der sich darin spiegelnden sprach- und kulturgeschichtlichen Traditionen.

Akademieprojekt ALMA – Wissensnetze in der mittelalterlichen Romania
Das ALMA-Projekt, getragen von den Akademien in Heidelberg, Mainz und München, untersucht unter nicht nur die Entwicklung romanischer Sprachen wie Altfranzösisch, Okzitanisch und Altitalienisch zu Wissenschaftssprachen (1100–1500), sondern auch die Entstehung und Struktur mittelalterlicher Wissensnetzwerke. Im Fokus stehen medizinische und juristische Texte, erschlossen in drei digitalen Mehrsprachenkorpora. Das Projekt verbindet Philologie, Linguistik und Digital Humanities. Ein innovativer Schwerpunkt liegt auf der Erstellung historisierter Ontologien. An der Saarbrücker Projektstelle wird insbesondere der italoromanische und sardische Bereich bearbeitet.
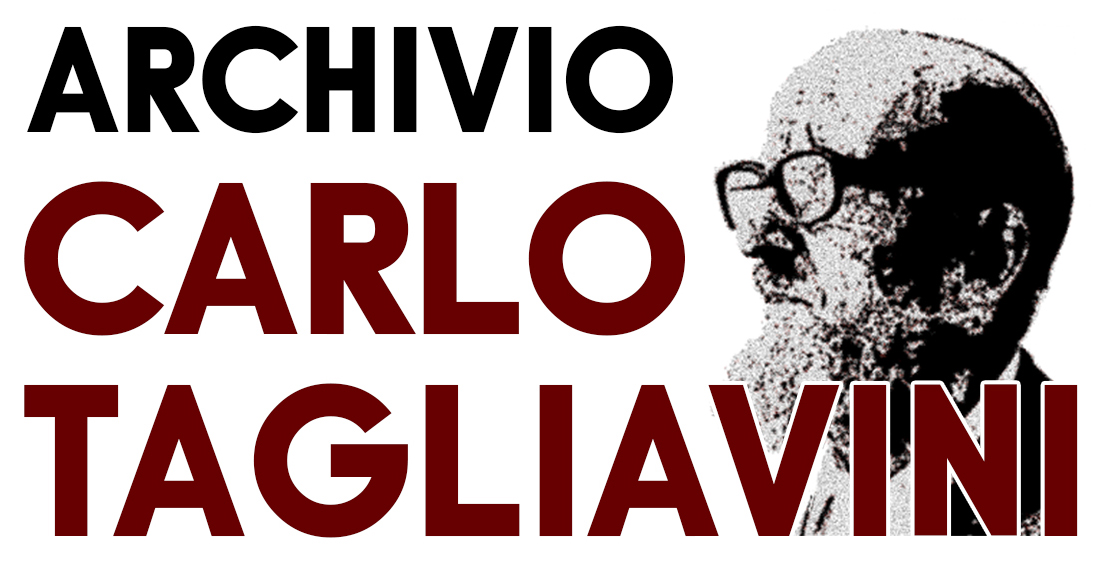
Archiv Carlo Tagliavini
Das bisher unerforschte und besonders reiche Privatarchiv des italienischen Philologen Carlo Tagliavini ist eine wahre Fundgrube für die Erforschung der Geschichte vor allem der Fächer Romanistik (insbesondere der Italianistik und der Balkanromanistik), Balkanologie (insbesondere der Albanologie) und der Indogermanistik. Unter anderem beinhaltet das sich im Privatbesitz befindende Archiv einige unveröffentlichte Werke Tagliavinis.
Ziel des Projektes ist es, durch die Analyse des Archivmaterials, einen Beitrag zur Geschichte der Romanistik und der Balkanlogie zu leisten, die inediti zu publizierten und einen Teil des Briefwechsels online zugänglich zu machen. Das Vorhaben wurde durch die freundliche Unterstützung der Familie Tagliavini ermöglicht.
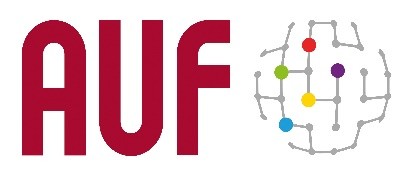
Arbeitsstelle für die wissenschaftliche Frankophonie in Deutschland
Die Arbeitsstelle für die wissenschaftliche Frankophonie in Deutschland (frz.: cellule francophone en Allemagne) ist eine nationale Repräsentation der Agence Universitaire de la Francophonie (AUF) an der Universität des Saarlandes. Diese Struktur wird von der Beauftragten für die wissenschaftliche Frankophonie in Deutschland (frz.: Référente de la francophonie scientifique en Allemagne), Prof. Dr. Claudia Polzin-Haumann (Lehrstuhl für Romanische Sprachwissenschaft), und dem Frankreichzentrum der Universität des Saarlandes koordiniert. Die Mission wird vom Saarland, Beobachtungsmitglied der Organisation internationale de la Francophonie (OIF), gefördert.
Das Ziel der Arbeitsstelle ist es, die Sichtbarkeit der wissenschaftlichen Frankophonie und ihrer Akteure in Deutschland zu stärken.

Centro di Studi Italiani Saarbrücken | Italienzentrum der Universität des Saarlandes
Das Italienzentrum bietet an der Universität des Saarlandes ein stets buntes und reichhaltiges Programm von spannenden wissenschaftlichen und kulturellen Aktivitäten rund um die Sprache, Kultur und Literatur Italiens an. Die wichtigsten Kooperationspartner des Italienzentrums sind die Langzeitprojekte Lessico Etimologico Italiano (LEI), das Zentrum für europäische Regional- und Minderheitensprachen Romania "minor" (eRMi) und die Wissensnetze in der mittelalterlichen Romania (ALMA). Es fördert somit die Kontakte zu Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler Italiens, italienischen Universitäten und akademischen Einrichtungen.

EuroCom
Europäische Mehrsprachigkeit und ihre Vermittlung bilden einen der Forschungsschwerpunkte der linguistischen und didaktischen Ausbildung in der Romanistik der Universität des Saarlandes. Die Interkomprehension als eines der innovativen Instrumentarien zum Zugang zu einer (zunächst rezeptiven) Mehrsprachigkeit steht dabei besonders im Fokus der Forschungsarbeiten. Der romanistische Zweig des Projekts EuroCom ist am Lehrstuhl für Romanische Sprachwissenschaft Prof. Dr. Claudia Polzin-Haumann angesiedelt und von Frau Dr. Christina Reissner koordiniert. Im Rahmen des Projekts sind Selbstlernräume zum digitalen Mehrsprachenlernen entstanden.

Französisch und mehr – Sprachenlernen im Saarland
Das Projekt Französisch und mehr, angesiedelt am Lehrstuhl für Romanische Sprachwissenschaft (Prof. Dr. Claudia Polzin-Haumann) und dem Institut für Sprachen und Mehrsprachigkeit in Kooperation mit der Staatskanzlei, leistet seit 2022 einen wichtigen Beitrag zur Förderung des Französischen und von Mehrsprachigkeit im Saarland. Es zielt darauf ab, (Mehr-)Sprachenlernen mit besonderer Berücksichtigung des Französischen für alle Saarländer*innen und Interessierte attraktiv, erlebbar und umsetzbar zu machen. Über das interaktive gleichnamige Portal Französisch und mehr, auf dem z.B. Französischkursangebote, deutsch-französische Veranstaltungshinweise und Tipps zum (Mehr-)Sprachenlernen zusammengestellt sind, sowie vielfältige Mitmachangebote bringt es die französische Sprache und Mehrsprachigkeit forschungsbasiert in Gesellschaft, Bildung, Arbeitswelt und Alltag, bspw. auch mit praxisnahen Französischlernangeboten in Kooperation mit dem Volkshochschul-Landesverband Saarland für Personen aus dem Gesundheitswesen.

Institut d'études françaises Saarbrücken
Das Institut d’Études Françaises – ein Deutsch-Französisches Zentrum (DFZ) – wurde 1956 gegründet. Träger des IEF ist seit 2020 die Deutsch-Französische Stiftung für kulturelle Zusammenarbeit. Neben der Förderung der französischen Sprache und der frankophonen Kultur im Saarland, ist die Förderung des interkulturellen Dialogs ein weiterer wichtiger Bestandteil seiner Arbeit und seines Engagements.
Ziel des IEF ist auch die Intensivierung der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit in der Großregion und die Vertiefung des interkulturellen Dialogs, insbesondere im europäischen Kontext. Das Kulturprogramm des IEF (Lesungen, Kinoabende, Konzerte, Debatten usw.) richtet sich dabei insbesondere an ein frankophones und frankophiles Publikum. Geleitet wird es von Prof. Dr. Anne-Sophie Donnarieix, die die Professur für Französische Literatur im europäischen Kontext inne hat.
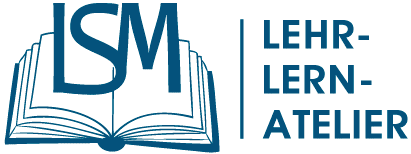
Institut für Sprachen und Mehrsprachigkeit mit Lehr-Lern-Atelier
Das Institut für Sprachen und Mehrsprachigkeit (ISM) liefert innovative Impulse für den Umgang mit sprachlicher und kultureller Vielfalt im schulischen Kontext. Ein zentraler Bestandteil des ISM ist das Lehr-Lern-Atelier, ein Raum für Schulprojekte, Seminare, Workshops und Vieles mehr. Das ISM steht seit seiner Gründung 2017 unter der Leitung von Prof. Dr. Claudia Polzin-Haumann (Lehrstuhl für romanische Sprachwissenschaft) und Prof. Dr. Julia Knopf (Lehrstuhl für Fachdidaktik Deutsch Primarstufe). Das LLA ist zudem Teil des Verbunds der Lernwerkstätten an der UdS.
Käte Hamburger Kolleg für kulturelle Praktiken der Reparation (CURE)
Das Käte Hamburger Kolleg für kulturelle Praktiken der Reparation (CURE) an der Universität des Saarlandes ist ein Institute for Advanced Studies und wird ab 2024 vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) gefördert. Die Direktion des Kollegs liegt bei Prof. Dr. Markus Messling und Prof. Dr. Christiane Solte-Gresser.
Ziel des Kollegs ist es, eine transmediale Theorie kultureller Reparationspraktiken und -prozesse in historischer und transkultureller Perspektive zu erarbeiten, aus der ein gesellschaftspolitisches Verständnis von kultureller Reparationspraxis entstehen soll. So will das Kolleg Wissen über individuelle und kollektive Reparationsprozesse in einer globalisierten Welt schaffen, das für ein zukünftiges Zusammenleben grundlegend ist, und zugleich einen Beitrag zur Neuausrichtung der Kulturwissenschaften leisten. Im Fokus der Forschung stehen Erinnerungskulturen und geschichtspolitische Diskurse, individuelle Erfahrungen von Verlust und Beschädigung sowie kulturökologische Fragen. Pro Jahr werden bis zu zwölf internationale Fellows im Kolleg forschen.
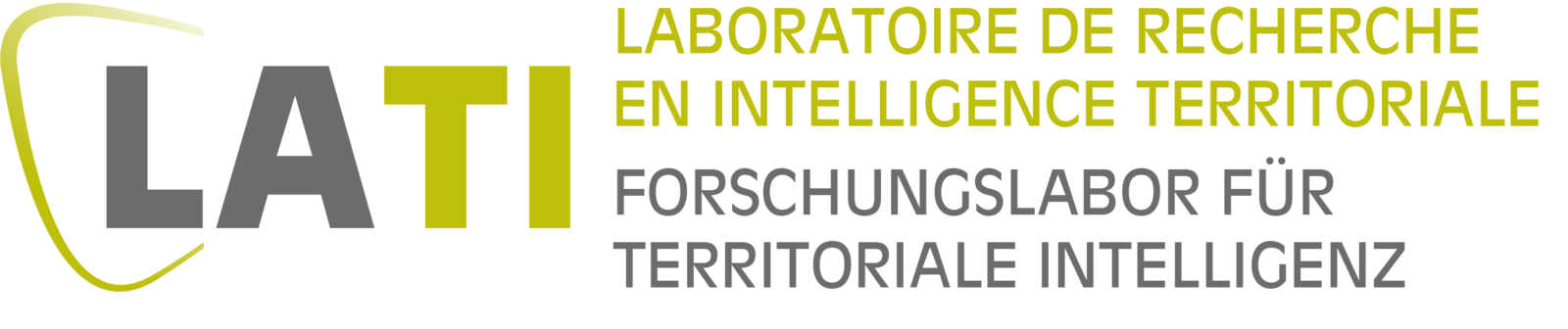
LATI – Forschungslabor für territoriale Intelligenz
Mehrsprachige Zusammenarbeit in der grenzüberschreitenden Raumplanung steht im Fokus des neuen Forschungsprojektes „LATI – Forschungslabor für territoriale Intelligenz“ der Universität der Großregion (= federführender Partner), das durch das Interreg VI A Großregion-Programm gefördert wird. Während Raumplanung von nationalen Strukturen geprägt ist, sind die Herausforderungen in den einzelnen Teilregionen, z.B. im Bereich Klimawandel oder verkehrsnahes Wohnen und Arbeiten, meist sehr ähnlich. Zentrales Anliegen innerhalb des grenzüberschreitenden Forschungsprojektes ist es daher, gemeinsame Lösungsansätze für die Großregion SaarLorLux+ zu erarbeiten.
Neben dem Fachwissen selbst spielen hier Sprache und Mehrsprachigkeit sowie der bewusste Umgang damit im Projektkontext eine entscheidende Rolle. Das Teilprojekt „Plurilinguale Kommunikation: Schlüsselfaktor in der multilingualen Projektarbeit“ unter der Leitung von Prof. Dr. Claudia Polzin-Haumann und Dr. Christina Reissner zielt darauf ab, einen nachhaltigen Beitrag zur Optimierung der fachlichen Kommunikation und der Zusammenarbeit der Akteure in der Großregion SaarLorLux+ zu leisten. Auf drei unterschiedlichen Ebenen (interne Kommunikation, externe Kommunikation, Outputs) soll dabei innerhalb des LATI-Projektes die Kooperation im mehrsprachigen Team untersucht und ein allgemeines Sprachenkonzept in der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit erstellt werden.
Projekt DÉRom
Die romanistische Linguistik hegt die Hoffnung, ein panromanisches etymologisches Wörterbuch nach dem Vorbild des REW (Romanisches Etymologisches Wörterbuch) von Meyer-Lübke zu erschaffen. Ein internationales, vor allem deutsch-französisches Team hat sich nun zum Ziel gesetzt, die Etymologie des gemeinsamen Kerns des romanischen Erbwortschatzes nach der Methode der vergleichenden Grammatik-Rekonstruktion neu aufzubauen und dessen phonologische, semantische, stratigraphische und variationale Analyse in digital-lexikografischer Form zu präsentieren. Das Ergebnis ist die erste Etappe des Dictionnaire Étymologique Roman (DÉRom).
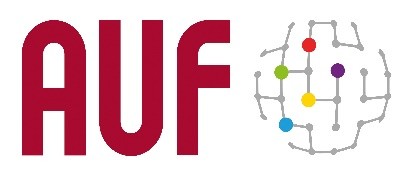
Promouvoir le Plurilinguisme dans la Professionnalisation Entrepreneuriale
In diesem Projekt arbeiten wir mit Forscher:innen der Université Antsiranana (Madagaskar) und der htw saar zusammen. Im Mittelpunkt steht die Rolle von Sprachen, Mehrsprachigkeit und interkulturellen Kompetenzen für ein integratives, verantwortungsbewusstes und nachhaltiges Unternehmertum.
Das Projekt wird im Rahmen des Programms Co//ectif von der Agence Universitaire de la Francophonie (AUF) kofinanziert.

SUUN: Saarländisch-Ukrainisches Universitätsnetzwerk
Die hispanistisch ausgerichtete wissenschaftliche Kooperation zwischen der Romanistik und der Ukraine geht bis ins Jahr 2009 zurück. Seither wurden kontinuierlich Finanzierungen im Rahmen der Ostpartnerschaften eingeworben, zahlreiche Wissenschaftsprojekte sowie Dozierenden- und Studierendenaustausch durchgeführt. Die zunächst mit der Petro Mohyla Black Sea National University von Mykolajiv begonnene Arbeit bezieht aktuelle Wissenschaftsfragen der Hispanistik und Lateinamerikanistik ein. Unsere gemeinsamen Buchpublikationen bearbeiten die Themen Transmedialität, Traum, Memoria, Trauma, Resilienz, Gewalt- und Kriegsdarstellungen in der spanischsprachigen Literatur, Film und Kunst. Im Zuge des Angriffskrieges gegen die Ukraine wechselte die Kooperation der Romanistik nach Lwiw und schloss neue Abkommen mit der Ukrainian Catholic University und der Universität Iwan Franko National University. Seit 01.07.2025 kooperiert der Lehrstuhl Reinstädler mit seinen ukrainischen Partner*innen in dem DAAD-geförderten Deutsch-Ukrainische, Hochschulnetzwerk. An der UdS werden unter dem Titel SUUN – Saar-Ukraine University Network: Overcoming Borders for a European Future innovative lehr- und Forschungskonzepte im Bereich der Geistes- und Kultur- und Sprachwissenschaften sowie Jura erarbeitet, die Grundlagen für eine nachhaltige, moderne europäische Universitätslandschaft bilden.

Zentrum für europäische Regional- und Minderheitensprachen
Das Projekt Romania „minor“ wurde 2013 von Univ.-Prof. Dr. Elton Prifti konzipiert und ins Leben gerufen. Zentrale Ziele dieses Lehr- und Forschungsprojektes sind:
- die systematische Vermittlung von fundierten sprachwissenschaftlich-philologischen sowie sprachpraktischen Kenntnissen über die sogenannten „kleinen“ romanischen Sprachen und Kulturen,
- die Förderung der Forschung im Bereich der Romania „minor“ sowie
- die umfassende Erörterung von innerromanischen Zusammenhängen.
Es richtet sich vor allem an Romanistik-Studierende und NachwuchswissenschaftlerInnen, die mehr über die sprachliche und kulturelle Vielfalt der Romania erfahren möchten, denn sie hört bekanntlich nicht bei den „großen“ romanischen Sprachen wie Spanisch, Französisch, Italienisch oder Portugiesisch auf, sondern fängt dort erst an.


