Arbeits- und Lebenswelten
Arbeit | Industrie | Gesellschaft
Forschungsprojekte

DFG-ANR-Projekt DesinEE
Deindustrialisierung in Frankreich und Deutschland. Erfahrungen und Emotionen von den 1960er Jahren bis heute. The Unmaking of the Working Class?
Die Deindustrialisierung stellt einen der grundlegendsten globalen Wandlungsprozesse unserer zeitgenössischen Gesellschaften dar. In Westeuropa mussten seit den 1960er Jahren „alte“ Industrien wie Kohlezechen, Stahlwerke, Textilfabriken oder Schiffswerften schließen. Mit dem damit zusammenhängenden Rückgang des industriellen Sektors war ein „sozialer Wandel von revolutionärer Qualität“ (Lutz Raphael) verbunden. Dieser war gekennzeichnet von Massenarbeitslosigkeit, der Zunahme sozialer Ungleichheiten sowie der Prekarität von Lebens- und Arbeitsverhältnissen. Entpolitisierung und der Aufstieg des Rechtsextremismus prägen seither viele von Deindustrialisierung betroffene Regionen.
Das internationale Verbundprojekt DesinEE unter der Leitung von Prof. Dr. Stefan Berger (Bochum), Prof. Dr. Emmanuel Droit (Strasbourg) und Prof. Dr. Fabian Lemmes (Saarbrücken), geht in fünf aufeinander abgestimmten Teilstudien in transnationaler Perspektive der Frage nach, wie sich die Deindustrialisierung in unterschiedlichen industriellen Räumen in Frankreich, West- und Ostdeutschland sowie Luxemburg auf die communautés ouvrières auswirkte. Dabei wird Deindustrialisierung als Ensemble lokalisierter ökonomischer, soziopolitischer und kultureller Erfahrungen untersucht, die sich in emotionalen Gemeinschaften von Arbeiter:innen von den frühen 1960er Jahren bis in die Gegenwart artikulieren. Während Mediendiskurse häufig von Niedergangsnarrativen, Nostalgie und mitunter Stigmatisierung geprägt sind, geht es uns darum, die Prozesse der Rekonfiguration sozialer und politischer Bindungen in ihrer ganzen Komplexität zu ergründen.
Mitwirkende: Prof. Dr. Fabian Lemmes | Dr. Brigit Metzger | Raphaël Pernoud, M.A. | Kaja Hauser, B.A. (Hilfskraft)
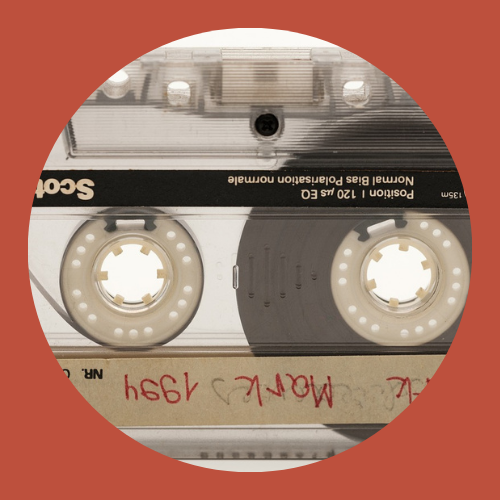
(Trans-)nationale Arbeitswelten und Erfahrungen in einer europäischen Grenzregion.
Digitale Erschließung narrativer Interviews sowie Vernetzung von Forschungsstrukturen
Das Projekt zielt auf die digitale Erschließung und Sicherung von Interviewbeständen sowie die Vernetzung der dazu forschenden Wissenschaftler:innen und Institutionen aus der Region Saar-Lor-Lux, die sich mit den Erfahrungen von Arbeiter:innen in den sich wandelnden Industriewelten im 20. und 21. Jahrhundert befassen. Allen lebensgeschichtlichen Zeugnissen ist gemein, dass die befragten Zeitzeug:innen auf den Wandel der Arbeitswelt und somit ihre Erfahrungswelten sowie Lebenswirklichkeiten eingehen. Insbesondere die Deindustrialisierung, der Prozess des Abbaus oder Rückgangs bestimmter Industriezweige, wird in den Interviews mit Themen wie den Auswirkungen auf das Alltagsleben, der sozialen Ungleichheit, der Geschichte von (Lohn-)Arbeit, der Arbeitskämpfe und der damit verbundenen Geschichte von Gewerkschaften verbunden. Es handelt sich also um einen zentralen Quellenbestand für das Verständnis der europäischen Zeitgeschichte. Die thematischen Schwerpunkte knüpfen an aktuelle nationale sowie internationale Forschungstendenzen und laufende Projekte an.
Mitwirkende: Prof. Dr. Fabian Lemmes |Dr. Birgit Metzger | Joana Baumgärtel, M.A. | Leah Rajchlin (Hilfskraft)

Postdoc-Projekt
Erfahrungen der Deindustrialisierung in einer transnationalen Grenzregion: eine histoire croisée des Saar-Lor-Lux-Raums
Birgit Metzger untersucht drei mittelgroße Städte im Saar-Lor-Lux-Raum, einer trinationalen Grenzregion. Diese Region war seit dem 19. Jahrhundert von Kohle, Eisen und Stahlindustrie geprägt und wirtschaftlich verflochten, gleichzeitigen bestanden nationale Rivalitäten und Konflikte. Deindustrialisierung ist in diesem Raum seit den 1960er Jahren eine geteilte Erfahrung, jedoch mit unterschiedlichen Tempi, Intensitäten und gesellschaftlichen Folgen. Sie erhöhte die grenzüberschreitende Mobilität, etwa wenn Lothringer:innen in den resistenteren Industrien des Saarlandes oder der expandierenden Dienstleistungsbranche in Luxemburg Arbeit fanden. Die Grenzlage war also potentiell eine Ressource; zugleich bot sie den Akteur:innen unmittelbare Vergleichsmöglichkeiten und machte Ungleichzeitigkeiten erfahrbar. Hier kommt zu den übergreifenden Projektfragen die Frage hinzu, wie sich die spezifischen Bedingungen des Grenzraums auf die Deindustrialisierungserfahrungen auswirkten, ob sie grenzüberschreitende Praktiken, Formen und Institutionen der Zusammenarbeit oder gar eine transnationale emotional community unter Arbeiter:innen entstehen ließen. Untersucht werden drei lokale Fälle, die massiv von der Schließung von Berg- und/oder Stahlwerken betroffen waren: die Mittelstadt Völklingen im Saarland, Creutzwald in der Moselle und die luxemburgische Stadt Esch-sur-Alzette.
Teilprojekt im internationalen Verbundprojekt DesinEE
Projektleitung: Dr. Brigit Metzger

Dissertationsprojekt: Zwischen Arbeits- und Lebenswelt. Sozialpolitik und Wohnungsbau im Bergbau der Saarregion, 1945–1990
Betreuung: Prof. Dr. Fabian Lemmes
Kontakt:
Joana Baumgärtel, M.A.
Das Forschungsprojekt untersucht die siedlungspolitischen Maßnahmen und deren Auswirkungen im Bergbau in der Saarregion von 1945 bis 1990. Ziel ist es, zu verstehen, wie sich nach dem Zweiten Weltkrieg soziale Strukturen entwickelten, wie diese das Leben und Arbeiten der Bergleute beeinflussten und welche Veränderungen sich im Laufe der Zeit ergaben. Ein akteurszentrierter Blick ermöglicht die Untersuchung, wie Staat, Bergbauverwaltung und gesellschaftliche Gruppen zusammenwirkten und wird ergänzt durch eine multiperspektivische Geschichtsschreibung mithilfe lebensgeschichtlicher Interviews von Zeitzeug:innen.

Dissertationsprojekt: Die politischen Auswirkungen der Deindustrialisierung. Eine deutsch-französische vergleichende Perspektive
Betreuung: Prof. Dr. Emmanuel Droit | Prof. Dr. Fabian Lemmes
Kontakt:
Raphaël Pernoud, M.A.
Das Forschungsprojekt im Rahmen des DFG-ANR-Projektes DesinEE untersucht fallspezifische Protestbewegungen gegen die Deindustrialisierung seit 1990 in einer deutsch-französischen vergleichenden Perspektive. Für den Vergleich werden zwei Industriestandorte aus dem Chemiesektor herangezogen, die plötzlich ins Rampenlicht der Medien geraten: ein Kaliwerk in Bischofferode (Thüringen) und eine ehemalige Viskosefabrik in Givet (französische Ardennes), die 1993 und 2000 nach heftigen Protesten geschlossen wurden. Die analytischen Schwerpunkte liegen auf der starken Medienberichterstattung der Protestbewegungen und der Strukturierung von Gefühlsgemeinschaften, die mit der Schließung der dortigen Industrie verbunden werden. Ziel ist also, die Erzeugung und Strukturierung von besonderen Emotionen durch die Deindustrialisierung in diesen beiden ländlichen Arbeitergemeinschaften zu hinterfragen, und zwar mithilfe lebensgeschichtlicher Interviews von Zeitzeug:innen und der Analyse medialer Diskurse.
Publikationen (Auswahl)
Joana Baumgärtel, Arbeitersiedlungsbau und Eigenheimstrategien im Saarland. Topografische und gesellschaftliche Raumbildungsprozesse nach 1945, in: Clemens Zimmermann/Gabriele B. Clemens/Katharina Thielen: Industriestädte. Historische Herausforderungen und aktuelle stadtpolitische Strategien, 2025.
Joana Baumgärtel, Finanzierung von Eigenheimen. Das Modell der saarländischen Bauinteressengemeinschaften nach dem Zweiten Weltkrieg, in: Zeitschrift für Agrargeschichte und Agrarsoziologie, Heft 1/2022, S. 83-97.
Birgit Metzger/Amerigo Caruso/Birgit Metzger (Hg): Grenzen der Sicherheit. Unfälle, Medien und Politik im deutschen Kaiserreich, Göttingen 2022.
Birgit Metzger, Creative Milieus: Concepts and Failures, in: Martina Heßler/Clemens Zimmermann (Hrsg.): Creative Urban Milieus. Historical Perspectives on Culture, Economy, and the City, Frankfurt –New York, 2008, S. 379–408.
Nachhören. Nachlesen.
Medienbeiträge des Lehrstuhls
|Prof. Dr. Fabian Lemmes zu Gast im Podcast "Historia Universalis"|
Prof. Dr. Fabian Lemmes als Experte im Geschichtspodcast "HISTORIA UNIVERSALIS" zu dem Thema: “Der Anarchismus. Idee – Praxis – Lebensform”
In dieser Episode begrüßt Podcaster Elias Prof. Dr. Fabian Lemmes, der in die Historie des Anarchismus einführt. Dabei werden einige missverstandene Vorstellungen und die Auswirkungen dieser politischen "Lebensform" analysiert. Hätten Sie beispielsweise gewusst, welche Verbindung die Grünen zum Anarchismus haben?
Hören Sie jetzt hier rein!
|Dr. Birgit Metzger zu Gast im Podcast "Der Rest ist Geschichte"|
Birgit Metzger als Expertin im Geschichtspodcast "Der Rest ist Geschichte" von Deutschlandfunk zu dem Thema:
Mythos Wald. Früher gefährlich, heute gefährdet
Borkenkäfer, Brände und Trockenheit setzen dem deutschen Wald zu. Damit ändert sich auch unsere Vorstellung vom Wald: vom Ort rauer Wildnis über eine romantisch verklärte Märchenkulisse hin zum bedrohten Ökosystem.
Hören Sie jetzt hier rein!

