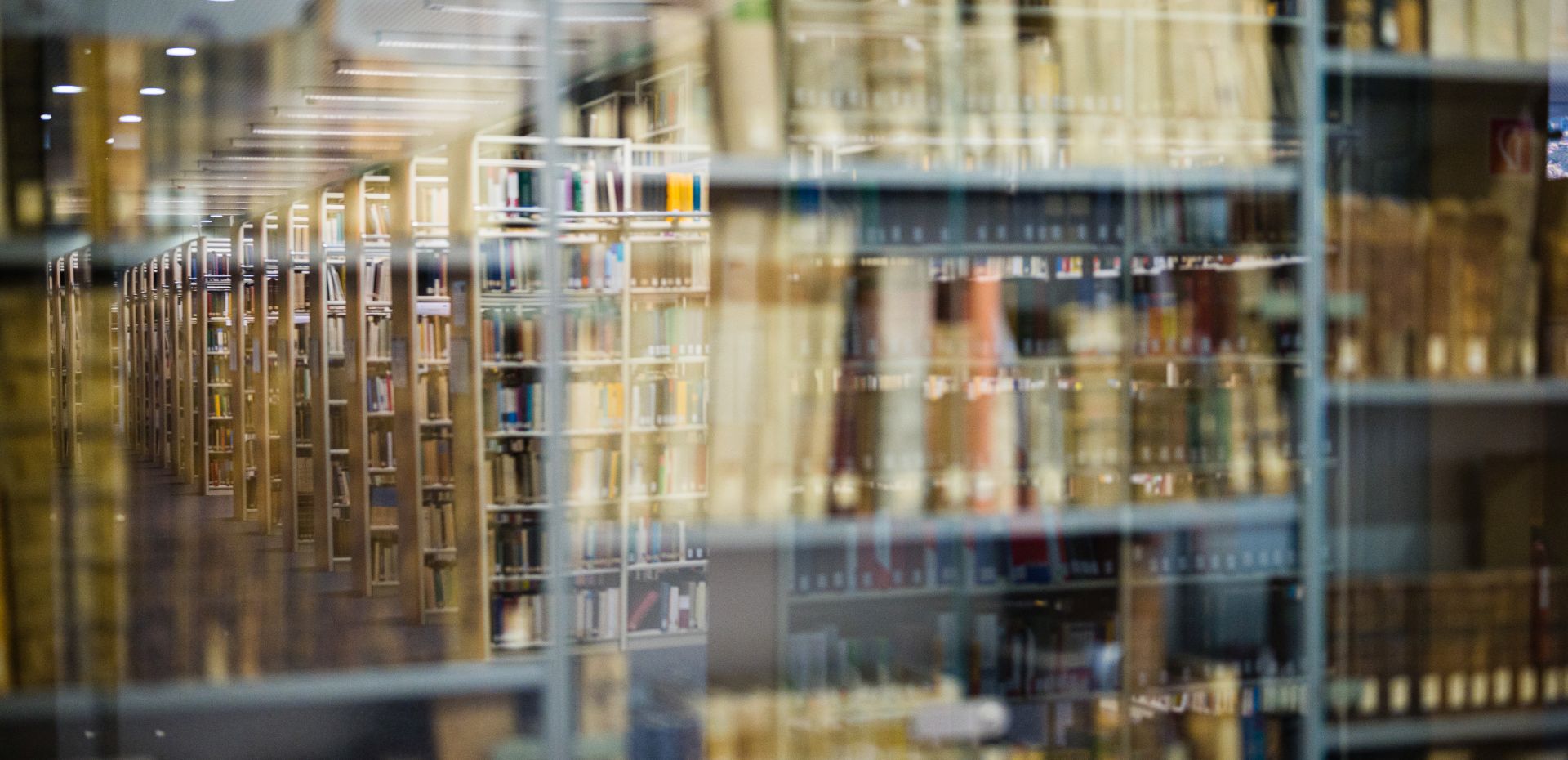Lehre
Aktuelle Veranstaltungen
Wintersemester 2025/26
Prof. Dr. Fabian Lemmes
Zeit: Montags 16:15 bis 17:45 Uhr
Raum: Gebäude C5 1 - MUSIKSAAL 1.01 (Hörsaal)
Dauer: 20.10.2025 bis 02.02.2026
Von „europäischer Geschichte“ spricht man meist mit großer Selbstverständlichkeit, doch wirft der Begriff zahlreiche Fragen auf. So ist keineswegs eindeutig, was Europa ist und wo seine Grenzen liegen. Dies gilt nicht nur in für gegenwärtige Debatten, auch und gerade in historischer Perspektive variierten die Vorstellungen beträchtlich. Unklar ist zudem, was eine historische Studie über einen bloßen geografischen Bezugsrahmen hinaus „europäisch“ macht, worin also Europäizität besteht. Und wie kann man die Geschichte des modernen Europas überhaupt erforschen und darstellen, wenn man sie weder als bloße Summe von Nationalgeschichten noch als teleologische Integrationsgeschichte schreiben will? Diesen Fragen wollen wir nachgehen.
Die Vorlesung bietet also keinen chronologischen Überblick über die europäische Geschichte der letzten 300 Jahre, vielmehr ist sie problem- und methodenorientiert und sucht Antworten auf die zentrale Frage: Wie kann man europäische Geschichte im Spannungsfeld von Nationalstaat, Transnationalität und Globalität schreiben und betreiben? Hierzu werden unterschiedliche Ansätze und Debatten vorgestellt – von der Begriffsgeschichte über den Historischen Vergleich, Kulturtransferforschung, Histoire croisée, transnationale Geschichte und Globalgeschichte bis zum Europäisierungsparadigma und Spatial Turn – und an ausgewählten Beispielen auf die europäische Geschichte des 18. bis 21. Jahrhunderts angewandt. Dabei blicken wir auf Europa als Idee und Repräsentation, Europa als Ordnung, Europa als Praxis, Verflechtungs-, Kommunikations- und und Erinnerungsraum, auf die Frage europäischer Spezifika, auf Grenzen und Grenzregionen und auf den Mittelmeerraum.
Einführende Literatur:
- Müller, Michael: Europäische Geschichte - Nur eine Sprachkonvention?, in: H-Soz-u-Kult, 31.05.2006, hsozkult.geschichte.hu-berlin.de/forum/2006-05-005.
- Schmale, Wolfgang: Europa: Kulturelle Referenz – Zitatensystem – Wertesystem, in: Europäische Geschichte Online (EGO), hg. vom Institut für Europäische Geschichte (IEG), Mainz 2010-12-03, www.ieg-ego.eu/schmalew-2010-de.
- Berger, Joachim/Willenberg, Jennifer/Landes, Lisa: EGO | Europäische Geschichte Online: Eine transkulturelle Geschichte Europas im Internet, in: Institut für Europäische Geschichte [IEG] (Hg.), Europäische Geschichte Online (EGO). www.ieg-ego.eu/introduction-2010-de.
- Patel, Kiran Klaus: Europa, in: Ernst Müller, Barbara Picht, Falko Schmieder (Hg.): Das 20. Jahrhundert in Grundbegriffen, Basel/Berlin 2024, DOI:10.31267/Grundbegriffe_19539752.
- Pernau, Margrit: Transnationale Geschichte, Göttingen 2011.
Zeit: Dienstags 10:15 bis 11:45 Uhr
Raum: Gebäude B3.1, Raum 3.18
Dauer: 21.10.2025 bis 03.02.2026
Beschreibung folgt in Kürze. Europäische Geschichte wird meist aus westeuropäischer Perspektive, mit Fokus auf die großen Mächte oder vom geografischen Zentrum her geschrieben. In diesem Seminar werden wir dagegen auf die nordöstliche Peripherie Europas blicken und die Geschichte eines Landes ergründen, von dem man in Deutschland außer Sauna und guten PISA-Ergebnissen sehr wenig weiß. Das Seminar soll einen Überblick über zentrale Aspekte der gesellschaftlichen, kulturellen, politischen und ökonomischen Entwicklung Finnlands von der schwedischen Zeit bis in die Gegenwart geben und in europäische Zusammenhänge einordnen.
Dabei werden wir auf manche Besonderheit stoßen, wie schon ein kurzer Blick auf die politische Entwicklung andeutet: seit dem Mittelalter zu Schweden gehörig, ab 1808 ein autonomer Teil des Russischen Reichs, 1906 das erste europäische Land mit Frauenwahlrecht, aber erst 1917 ein unabhängiger Staat (mit zwei Landessprachen: Finnisch und Schwedisch); im Zweiten Weltkrieg erst Kooperationspartner NS-Deutschlands, dann von der Wehrmacht im nördlichen Landesteil verwüstet; im „Kalten Krieg“ neutral und Vermittler zwischen den Blöcken, seit 1995 EU-Mitglied und erst 2023 der NATO beigetreten. Es wird aber nicht nur um „große“ Politik gehen, sondern vor allem auch um Gesellschaftsentwicklungen zwischen Tradition und Modernisierung, Industrialisierung und Deindustrialisierung, um die Nationalbewegung des 19. Jahrhunderts und Erinnerungsorte, Sprach- und Schulpolitik, Migration, deutsch-finnische Beziehungen, Kultur und Kulturtransfer.
Einführende Literatur:
- Meinander, Henrik: Finnlands Geschichte. Linien, Strukturen, Wendepunkte, Bad Vilbel 2017.
- Bohn, Ingrid: Finnland. Von den Anfängen bis zur Gegenwart, Regensburg 2005.
- Hösch, Edgar: Kleine Geschichte Finnlands (Beck'sche Reihe, Bd. 1889), München 2009.
- Kirby, David: A Concise History of Finland, Cambridge 2006.
Zeit: Mittwochs 10:15 bis 11:45 Uhr
Raum: Gebäude B3.1, Raum 3.18
Dauer: 21.10.2025 bis 04.02.2026
Anarchismus ist nicht nur eine politische Ideologie, sondern auch eine soziale Bewegung, Praxis und Lebensform. Seit der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts verbreiteten sich anarchistische Gruppen überall in Europa und auf dem Globus. Ein gewisses Revival erlebte der Anarchismus zuletzt im Rahmen der Global-Justice-Bewegungen des frühen 21. Jahrhunderts. Wie für alle sozialen Bewegungen spielen Medien auch für den Anarchismus eine zentrale Rolle. Denn zum Wesen sozialer Bewegungen gehört es, Protest in der Öffentlichkeit zu artikulieren, Aufmerksamkeit für bestimmte Anliegen zu erzeugen und an unterschiedliche Publika zu kommunizieren. Auch zur internen Kommunikation und Schaffung eines Zusammengehörigkeitsgefühls sind Medien relevant. Und nicht zuletzt ist die (massen)mediale Berichterstattung über die Bewegungen ein wesentlicher Faktor.
Was können wir durch die mediengeschichtliche Perspektive über Anarchismus und soziale Bewegungen im Allgemeinen lernen? Was lehrt uns umgekehrt der Blick auf den Anarchismus über Medien und Öffentlichkeiten? Diesen Leitfragen geht das Seminar in vergleichender und transnationaler Perspektive nach. Diese Perspektive ist für unser Thema besonders relevant, weil Anarchist:innen infolge von Arbeitsmigration, Verfolgung und Exil wie kaum eine andere soziale und politische Bewegung transnational und global agierten. Unser Blick richtet sich auf Fallbeispiele innerhalb und außerhalb Europas vom 19. Jahrhundert bis in die jüngste Zeit. Dabei untersuchen wir einerseits Medien und mediale Praktiken der Anarchist:innen (Flugblätter, Broschüren, Zeitungen und Zeitschriften, Lieder, Blogs, öffentliche Aktionen, Rituale…), andererseits (massen)mediale Diskurse über Anarchist:innen, ihre Kontextbedingungen und Folgen.
Einführende Literatur:
- Dominique F. Miething, Anarchismus, in: Samuel Salzborn (Hrsg.), Handbuch Politische Ideengeschichte. Zugänge – Methoden – Strömungen, Stuttgart 2018, S. 196-207.
- Marchi, Regina: Media and Social Movements, in: Philip M. Napoli (Hg.): Mediated Communication, Berlin, Boston 2018, Kap. 31.
- Mike Finn: Debating Anarchism. A History of Action, Ideas and Movements, New York 2021
- Frank Bösch: Kommunikative Netzwerke. Zur glokalen Formierung sozialer Bewegungen am Beispiel der Anti-Atomkraftproteste, in: Mittag, Jürgen / Stadtland, Helke (Hg.): Theoretische Ansätze und Konzepte der Forschung über soziale Bewegungen in der Geschichtswissenschaft, Essen 2014, S. 149-166.
- Fabian Lemmes: Neue Wege der historischen Anarchismusforschung (19. bis 21. Jahrhundert), in: Archiv für Sozialgeschichte 60 (2020), S. 435-484.
- Daniel Loick: Anarchismus zur Einführung, Hamburg 2017.
- Carl Levy/Matthew S. Adams (Hg.): The Palgrave Handbook of Anarchism, Cham 2019.
Zeit: Dienstags 16:15 bis 17:45 Uhr
Raum: Gebäude B3.1, Raum 3.18
Dauer: 21.10.2025 bis 03.02.2026
Im Kolloquium werden neuere Forschungen und Ansätze zur Kultur-, Medien- und Gesellschaftsgeschichte des 18. bis 21. Jahrhunderts diskutiert. Auf dem Programm stehen Vorträge von auswärtigen Gästen und von Forscher:innen der UdS, die laufende oder abgeschlossene Projekte präsentieren. Darüber hinaus bietet das Kolloquium Studierenden die Möglichkeit, ihre laufenden Abschlussarbeiten zur Diskussion zu stellen. Alle Interessierten sind herzlich willkommen.
Unser Regeltermin ist Dienstag 16-18 Uhr, einige Termine werden jedoch an anderen Tagen bzw. Zeiten stattfinden. Das genaue Programm wird zur ersten Sitzung bekanntgegeben.
Julika Badstieber-Waldt, M.A.
Zeit: Mittwochs 08:30 bis 10:00 Uhr
Raum: B3.1, Seminarraum 3.19
Dauer: 15.010.2025 bis 04.02.2026
„Um Gottes willen, schweigen Sie! Sagen Sie das Herrn Hitler, gehen Sie!“, so die fiktive Antwort des Apostolischen Nuntius Cesare Orsenigo auf die Berichte des SS-Obersturmführers Kurt Gerstein über die Ermordung der jüdischen Bevölkerung in den Konzentrationslagern in Polen 1942 in Rolf Huchhuths Stück Der Stellvertreter. Spätestens seit dessen Uraufführung im Februar 1963 auf der Freien Volksbühne in Westberlin ist die Frage über die Haltung der christlichen Kirchen zur Zeit des Nationalsozialismus und insbesondere im Zweiten Weltkrieg Gegenstand umfassender und auch hitziger öffentlicher und wissenschaftlicher Debatten geworden. Auch in den ehemalig besetzten Ländern Belgien und Frankreich finden sie bis heute lebhaft statt. Welche Rolle(n) kam(en) der katholischen und evangelischen Kirche also im sogenannten „Dritten Reich“, im besetzten Belgien und Frankreich zu? Das Proseminar macht es sich zur Aufgabe, Verhalten und Handlungsoptionen von kirchlichen Akteur*innen in der Zeit von 1939-1945 zu beleuchten und fragt im Sinne einer transnationalen Geschichte nach Interaktionen, Zirkulationen und Retroeffekten.
Einführende Literatur:
- Martin Conway.: „The Christian Churches and Politics in Europe, 1914-1939“, in: Hugh Mcloed (Hrsg.): The Cambridge History of Christianity. Band 9, World Christianities C.1914-C.2000, Cambridge 2006, S. 151-178.
- Jacques Duquesne: Les catholiques franҫais sous l'Occupation, Paris 1966.
- Fabrice Maerten (et.al.) (Hrsg.): Entre La Peste et Le Choléra. Vie et Attitudes Des Catholiques Sous l’Occupation, Gerpinnes 1999.
- Christoph Kösters (et.al.) (Hrsg.): Die katholische Kirche im Dritten Reich. Eine Einführung, 2. Auflage, Freiburg 2018.
- Christoph Strohm: Die Kirchen im Dritten Reich, 2., durchgesehene Auflage, München 2017.
- Mark Edward Ruff: Katholische Kirche und Nationalsozialismus. Erinnerungspolitik und historische Kontroversen in der Bundesrepublik 1945-1980. Übersetzt von Charlotte P. Kieslich, Paderborn 2022.
Zu diesem Proseminar findet ein begleitendes Tutorium zur Methodik wissenschaftlichen Arbeitens statt. Bitte beachten Sie, dass die Teilnahme am Tutorium VERPFLICHTEND ist. Dieses findet zweiwöchentlich montags 14:15-15:45 in Gebäude B3 1, Raum 1.15 unter der Leitung von Timo Spath statt.
Zeit: Dienstags 14:15 bis 15:45 Uhr
Raum: Gebäude B4 1, Raum 0.02.1
Dauer: 14.10.2025 bis 03.02.2026
„Die Grenzen meiner Sprache bedeuten die Grenzen meiner Welt“. Über Ludwig Wittgensteins berühmten Satz kann man sicherlich streiten. Unverkennbar aber prägt Sprache unseren Denkhorizont und kann das Erlernen einer neuen oder das Vertiefen einer Fremdsprache unser Denken bereichern. Fremdsprachenkenntnisse sind für Historiker*innen heute unerlässlich und ermöglichen eine internationale Vernetzung mit anderen Wissenschaftler*innen und die Teilhabe am wissenschaftlichen Diskurs. Die Übung macht es sich zum Ziel, Historiker*innen weitere Sprachkenntnisse im Französischen aufzuschließen. Anhand der Betrachtung der deutsch-französischen Beziehungen von 1945 bis in die Gegenwart sollen Diskussionen geführt, Fachsprache vertieft und Einblicke in die (deutsch-)französische Historiographie gewährt werden.
Einführende Literatur:
- Julika Badstieber-Waldt: »Erbfeinde« - »Erbfreunde«? Mythen der deutsch-französischen Beziehungen / « Ennemis héréditaires » - « Amis héréditaires » ? Les mythes des relations franco-allemandes », in: Ursula Sinnreich (Hrsg.): Auf dem Weg in die Zukunft. Die deutsch-französischen Beziehungen 100 Jahre nach dem Ersten Weltkrieg / En route vers l’avenir. Les relations franco-allemandes, 100 ans après la Première Guerre mondiale, Berlin: Hatje Cantz 2020, S. 122-148.
- Nicole Colin (et.al.) (Hrsg.): Dictionnaire des relations culturelles franco-allemandes depuis 1945, Villeneuve d’Ascq 2023.
- Corine Defrance/Ulrich Pfeil: La France, l’Allemagne et le traité de l’Élysée, Paris 2012.
- Dies. (Hrsg.): Verständigung und Versöhnung nach dem 'Zivilisationsbruch'?, Schriftenreihe: Band 1731. Bundeszentrale f. politische Bildung, Bonn 2016.
- Hélène Miard-Delacroix: Le défi européen. Histoire Franco-allemande de 1963 à nos jours, Villeneuve d’Ascq 2011.
- Dies./Andreas Wirsching: Ennemis héréditaires? Un dialogue franco-allemand, avec Andreas Wirsching, Paris 2020.
- Isabelle Guinaudeau (et.al.) (Hrsg): Dictionnaire des relations franco allemandes, Bordeaux 2009.
Martin Kloza, M.A.
Zeit: Donnerstags 10:15–11:45 Uhr
Raum: Gebäude B3 1 - Seminarraum 1.24
Dauer: 16.10.2025 bis 05.02.2026
Während der Besatzung Polens und Frankreichs, welche unterschiedlichen Besatzungsregimen unterstanden, verfolgte das Dritte Reich das Ziel einer geographischen und – im NS-Verständnis – völkischen Neuordnung. Neben Eingliederung bestimmter Teile ins ‘Altreich’ gehörten hierzu unterschiedliche Machtinstrumente wie die Rekrutierung der Bevölkerung für das ‘deutsche Volkstum’ (u.a. Nordfrankreich) oder die An- und Umsiedlung zwecks ‘Germanisierung’ des Gebietes (sog. Warthegau bzw. Großpolen). Das Generalgouvernement hingegen sollte vorerst als Sammelbecken für unterschiedliche Bevölkerungsgruppen dienen. Dort auch lagen Städte wie Warschau, wo sich das größte jüdische Ghetto befand, sowie die NS-Vernichtungslager. Das Dritte Reich wandte folglich Mittel der Inklusion wie Exklusion – bis hin zum Völkermord – an, um die deutsch beherrschten Teile des europäischen Kontinents nach seiner Ideologie und Machtvorstellung zu ordnen; in dieser Übung am Beispiel Frankreichs und Polens.
Im Kurs werden wir uns vor allem mit den Auswirkungen auf die betroffenen Regionen und Menschen sowie mit ihren Handlungsmöglichkeiten im Kriegs- und Besatzungsalltag befassen. Dazu gehören das Leben im Warschauer Ghetto, die Motivationen, ‘Volksdeutscher’ zu werden, Widerstand gegen die NS-Besatzung usw.
Neben Referaten werden Quellentexte und Fachliteratur im Mittelpunkt der Übung stehen. Die Inhalte werden ferner durch Aspekte wissenschaftlicher Arbeitsmethoden gerahmt (Recherche, Fragestellungen und Thesen aufstellen usw.). Für die Teilnahme sind Kenntnisse des Französischen und, oder Polnischen von Vorteil, wenngleich keine Voraussetzung.
Literatur:
- Benz, Wolfgang u.a. (Hgg.): Deutsche Herrschaft. Nationalsozialistische Besatzung Europas und die Folgen, München 2022.
- Benz Wolfgang: Holocaust, 10., aktual. Auflage, München 2023.
- Jäckel, Eberhard: Frankreich in Hitlers Europa. Die deutsche Frankreichpolitik im Zweiten Weltkrieg, Stuttgart 1966.
- Kochanowski, Jerzy u.a. (Hg.): Die „Volksdeutschen” in Polen, Frankreich, Ungarn und der Tschechoslowakei. Mythos und Realität, Osnabrück 2006.
- Leniger, Markus: Nationalsozialistische „Volkstumsarbeit“ und Umsiedlungspolitik 1933-45. Von der Minderheitenbetreuung zur Siedlungsauslese, Berlin 2006 (Geschichtswissenschaft, Bd. 6).
- Stiller, Alexa: Völkische Politik. Praktiken der Exklusion und Inklusion in polnischen, französischen und slowenischen Annexionsgebieten 1939-1945, Göttingen 2022.
Raphaël Pernoud, M.A.
Zeit: Dienstags 12:15–13:45 Uhr
Raum: Gebäude B3 1 - Seminarraum 1.24
Dauer: 14.10.2025 bis 03.02.2026
Während der Besatzung Polens und Frankreichs, welche unterschiedlichen Besatzungsregimen unterstanden, verfolgte das Dritte Reich das Ziel einer geographischen und – im NS-Verständnis – völkischen Neuordnung. Neben Eingliederung bestimmter Teile ins ‘Altreich’ gehörten hierzu unterschiedliche Machtinstrumente wie die Rekrutierung der Bevölkerung für das ‘deutsche Volkstum’ (u.a. Nordfrankreich) oder die An- und Umsiedlung zwecks ‘Germanisierung’ des Gebietes (sog. Warthegau bzw. Großpolen). Das Generalgouvernement hingegen sollte vorerst als Sammelbecken für unterschiedliche Bevölkerungsgruppen dienen. Dort auch lagen Städte wie Warschau, wo sich das größte jüdische Ghetto befand, sowie die NS-Vernichtungslager. Das Dritte Reich wandte folglich Mittel der Inklusion wie Exklusion – bis hin zum Völkermord – an, um die deutsch beherrschten Teile des europäischen Kontinents nach seiner Ideologie und Machtvorstellung zu ordnen; in dieser Übung am Beispiel Frankreichs und Polens.
Im Kurs werden wir uns vor allem mit den Auswirkungen auf die betroffenen Regionen und Menschen sowie mit ihren Handlungsmöglichkeiten im Kriegs- und Besatzungsalltag befassen. Dazu gehören das Leben im Warschauer Ghetto, die Motivationen, ‘Volksdeutscher’ zu werden, Widerstand gegen die NS-Besatzung usw.
Neben Referaten werden Quellentexte und Fachliteratur im Mittelpunkt der Übung stehen. Die Inhalte werden ferner durch Aspekte wissenschaftlicher Arbeitsmethoden gerahmt (Recherche, Fragestellungen und Thesen aufstellen usw.). Für die Teilnahme sind Kenntnisse des Französischen und, oder Polnischen von Vorteil, wenngleich keine Voraussetzung.
Empfohlene Literatur:
- Benz, Wolfgang u.a. (Hgg.): Deutsche Herrschaft. Nationalsozialistische Besatzung Europas und die Folgen, München 2022.
- Benz Wolfgang: Holocaust, 10., aktual. Auflage, München 2023.
- Jäckel, Eberhard: Frankreich in Hitlers Europa. Die deutsche Frankreichpolitik im Zweiten Weltkrieg, Stuttgart 1966.
- Kochanowski, Jerzy u.a. (Hg.): Die „Volksdeutschen” in Polen, Frankreich, Ungarn und der Tschechoslowakei. Mythos und Realität, Osnabrück 2006.
- Leniger, Markus: Nationalsozialistische „Volkstumsarbeit“ und Umsiedlungspolitik 1933-45. Von der Minderheitenbetreuung zur Siedlungsauslese, Berlin 2006 (Geschichtswissenschaft, Bd. 6).
- Stiller, Alexa: Völkische Politik. Praktiken der Exklusion und Inklusion in polnischen, französischen und slowenischen Annexionsgebieten 1939-1945, Göttingen 2022.
Sommersemester 2025
Prof. Dr. Fabian Lemmes
Zeit: Montags 16:15 bis 17:45 Uhr
Raum: Gebäude C5 1 - MUSIKSAAL 1.01 (Hörsaal)
Dauer: 07.04.2025 bis 14.07.2025
Es handelt sich um die Fortsetzung der im Wintersemester begonnen Überblicksvorlesung zur Mediengeschichte vom 18. Jahrhundert bis in die Gegenwart. Die Belegung von Teil I ist aber keine Voraussetzung für die Belegung dieses zweiten Teils.
Die Vorlesung will die Studierenden mit zentralen Ansätzen, Fragestellungen, Themen und Quellen der Mediengeschichte vom 18. bis ins 21. Jahrhundert vertraut machen. Sie bietet weniger einen chronologischen Überblick als eine problemorientierte Einführung. Was sind Medien und wie haben sie sich entwickelt? In welchem Zusammenhang stehen mediale Entwicklungen mit breiteren historischen Prozessen und was macht sie für uns interessant? Welche unterschiedlichen disziplinären und methodischen Zugänge zur Mediengeschichte gibt es? Dabei wird eine vergleichende und transnationale Perspektive vermittelt. Es geht also nicht nur um Deutschland, sondern auch um weitere europäische sowie punktuell auch um außereuropäische Kontexte.
Einführende Literatur:
- Frank Bösch: Mediengeschichte. Vom asiatischen Buchdruck zum Computer, 2. Aufl., Frankfurt a.M./New York 2019.
- Jane Chapman: Comparative Media History. An Introduction, Cambridge 2005.
- Werner Faulstich: Mediengeschichte von 1700 bis ins 3. Jahrtausend, Stuttgart 2006.
- Werner Faulstich: Die Mediengeschichte des 20. Jahrhunderts, München 2012.
- Jürgen Wilke: Grundzüge der Medien- und Kommunikationsgeschichte, 2. Aufl., Köln/Weimar/Wien 2008.
Zusammen mit Prof. Dr. Mechthild Gilzmer
Zeit: Dienstags 10:15 bis 11:45 Uhr
Raum: Gebäude B3.1, Raum 3.18
Dauer: 08.04.2025 bis 15.07.2025
In diesem Seminar soll die besondere Rolle des Gestapo-Lagers Neue Bremm als einer zentralen Drehscheibe für die Deportation von Frauen aus Frankreich betrachtet werden. Insgesamt wurden während des Zweiten Weltkriegs 9000 Frauen aus Frankreich deportiert, 7000 kamen ins Konzentrationslager Ravensbrück, ein Drittel von ihnen über Saarbrücken. In zahlreichen Augenzeugenberichten wird der Aufenthalt im Gestapo-Lager Neue Bremm als ein zentraler Moment des Übergangs in eine andere Welt beschrieben: die Überschreitung nicht nur einer Landesgrenze, sondern auch der ersten Begegnung mit dem nationalsozialistischen System der Entmenschlichung.
Im Seminar werden wir den historischen Kontext der Repression und Verfolgung von Frauen aus Frankreich erarbeiten und die betroffenen Frauen im Hinblick auf die Gründe für ihre Verhaftung, Inhaftierung und Deportation aus Genderperspektive untersuchen. Daneben werden wir auch andere in der Neuen Bremm inhaftierte Verfolgtengruppen, insbesondere Frauen aus der Grenzregion und Zwangsarbeiterinnen betrachten. Schließlich soll die Erinnerung an diese Geschichte thematisiert werden.
Ein Besuch der Gedenkstätte Neue Bremm mit Führung und in Kooperation mit Akteuren der Erinnerung ist ebenso Teil des Seminars wie eine Exkursion nach Esch/Luxemburg zum Nationalen Widerstandsmuseum am Mittwoch, den 23. April 2025. Dort wird ab März 2025 eine Ausstellung zum Thema "Widerstand und Deportation von Frauen aus Frankreich" gezeigt. Angedacht sind auch eine eintägige Exkursion nach Paris und/oder Veranstaltungen mit anderen Kooperationspartnern (Kino 8 1/2, Institut Français; Frankreichzentrum).
Das interdisziplinäre Seminar richtet sich an Studierende der Geschichtswissenschaft, Hok/AK, Europawissenschaften, Romanistik, Gender Studies, Border Studies u.ä. Es bietet die Möglichkeit für projektorientierte, biographische Arbeiten mit dem Ziel, diese auch digital umzusetzen (podcast). 1400 Frauen sind namentlich erfasst, zu rund einem Dutzend prominenter Häftlingsfrauen gibt es vielfältiges (Video- und Audio-)Material. Ein Besuch des Landesarchivs soll dazu dienen, weiteres Archivmanterial zu erschließen. Für solche Arbeiten sind gute Französischkenntnisse hilfreich. Sie sind aber keine Teilnahmebedingung und werden nicht vorausgesetzt.
Einführende Literatur:
- Sprute, Hannah / Gilzmer, Mechthild (Hg.): Frauen aus Frankreich im KZ-Ravensbrück (1942-1945). Deutsch-französische Forschungsperspektiven, Metropol-Verlag, Berlin 2023.
- Thalhofer, Elisabeth: Neue Bremm – Terrorstätte der Gestapo. Ein Erweitertes Polizeigefängnis und seine Täter 1943–1944. Vollständig überarbeitete und ergänzte Neuausgabe, St. Ingbert, Röhrig Universitätsverlag, 2019.
- Bernard, Horst: Neue Bremm - das Lager. Ehemalige Häftlinge des Gestapolagers Neue Bremm erinnern sich, Blattlaus-Verlag, Saarbrücken 2014.
Die Veranstaltung findet interdisziplinär in Zusammenarbeit mit der Romanistik statt.
Zeit: Mittwochs 10:15 bis 11:45 Uhr
Raum: Gebäude B3.1, Raum 3.18
Dauer: 09.04.2025 bis 16.07.2025
Soziale Bewegungen sind mobilisierte Netzwerke von Personen und Gruppen, die durch kollektive Aktionen sozialen Wandel herbeiführen, verhindern oder rückgängig machen wollen. Solche Protestbewegungen haben in der Geschichte seit der Französischen Revolution immer wieder eine wichtige Rolle gespielt. Eine neue Dynamik haben sie seit den 1970er Jahren entfaltet (die sog. „Neuen soziale Bewegungen”).
Zum Wesen sozialer Bewegungen gehört es, Protest in der Öffentlichkeit zu artikulieren, Aufmerksamkeit zu erzeugen und mit unterschiedlichen Publika zu kommunizieren. Daher liegt es auf der Hand, dass Medien und die Medienstrukturen einer Gesellschaft für sie eine wichtige Rolle spielen. Umso erstaunlicher ist es, dass mediengeschichtliche Perspektiven bisher in der Forschung zu sozialen Bewegungen kaum vorkommen. Im Seminar wollen wir genau eine solche mediengeschichtliche Perspektive einnehmen und gemeinsam ergründen, inwiefern sie uns hilft, die Geschichte sozialer Bewegungen besser zu verstehen. Dabei fragen wir zum einen nach dem Verhältnis zwischen sozialen Bewegungen und den etablierten (Massen)Medien und der Darstellung sozialer Bewegung in den Massenmedien. Zum anderen untersuchen wir die Medien der sozialen Bewegungen selbst, denn um untereinander zu kommunizieren und ihre Anliegen in die Öffentlichkeit zu tragen, produzierten und nutzten soziale Bewegungen vielfach eigene, alternative Medien (von Flugblättern, Broschüren und Zeitungen bis zu internetbasierten Formaten).
In vergleichender und transnationaler Perspektive werden wir auf unterschiedliche Bewegungen des 19. bis 21. Jahrhunderts in Europa (und teilweise darüber hinaus) blicken – von Antisklaverei-, Arbeiter- und Frauenbewegung über anarchistische, faschistische und rechtsextreme Bewegungen, Anti-Atomkraft und Umweltbewegung bis hin zur Occupy-Bewegung.
Einführende Literatur:
- Mittag, Jürgen / Stadtland, Helke (Hg.): Theoretische Ansätze und Konzepte der Forschung über soziale Bewegungen in der Geschichtswissenschaft, Essen 2014, darin insbesondere der Beitrag von Frank Bösch: Kommunikative Netzwerke. Zur glokalen Formierung sozialer Bewegungen am Beispiel der Anti-Atomkraftproteste, S. 149-166.
- Marchi, Regina: Media and Social Movements, in: Philip M. Napoli (Hg.): Mediated Communication, Berlin, Boston 2018, Kap. 31.
- Tilly, Charles / Castañeda, Ernesto / Wood, Lesley J.: Social Movements, 1768-2018, 4. Aufl., New York, NY 2020.
- Rucht, Dieter / Neidhardt, Friedhelm: Soziale Bewegungen und kollektive Aktionen, in: Hans Joas / Steffen Mau (Hg.): Lehrbuch der Soziologie, 4. Aufl., Frankfurt 2020, S. 831-864.
Zeit: Dienstags 16:00 bis 18:00 Uhr
Raum: Gebäude B3.1, Raum 3.18
Dauer: 15.10.2024 bis 04.02.2025
Im Kolloquium werden neuere Forschungen und Ansätze zur Kultur-, Medien- und Gesellschaftsgeschichte des 18. bis 21. Jahrhunderts diskutiert. Auf dem Programm stehen Vorträge von auswärtigen Gästen und von Forscher:innen der UdS, die laufende oder abgeschlossene Projekte präsentieren. Darüber hinaus bietet das Kolloquium Studierenden die Möglichkeit, ihre laufenden Abschlussarbeiten zur Diskussion zu stellen. Alle Interessierten sind herzlich willkommen.
Unser Regeltermin ist Dienstag 16-18 Uhr, einige Termine werden jedoch an anderen Tagen bzw. Zeiten stattfinden. Das genaue Programm wird zur ersten Sitzung bekanntgegeben.
Dr. Gunter Mahlerwein
Zeit: Dienstags 14:15 bis 15:45 Uhr
Raum: B3 1, Raum 2.17
Dauer: 08.04.2025 bis 15.07.2025
Von Anfang an spielte Musik in der Kinogeschichte eine wesentliche Rolle, waren es zunächst Pianisten und Organisten, kleinere Ensembles und große Orchester, die die Stummfilme live begleiteten, wurde über den kurzen Umweg der Filmuntermalung mit Schallplatten mit der Einführung des Tonfilms Musik endgültig zu einem unabdingbaren Bestandteil von Film.
In der Übung soll an verschiedenen Kinofilmen und TV-Serien der Einsatz von Musik analysiert werden. Es sind dafür keine musikalischen Fach-/Notenkenntnisse erforderlich, vielmehr soll eine Methode entwickelt werden, über Höranalysen den Effekt von Musik im Film allgemeinverständlich zu beschreiben.
Dabei sind insbesondere die Filme interessant, in denen Musik diegetisch, also als Teil der Filmhandlung, als auch nicht-diegetisch, als die Filmhandlung klanglich unterstützendes Element eingesetzt wird. Zudem ist gerade für TV-Serien die Bedeutung von Titelsongs/signature songs im Intro hervorzuheben, die zudem die Verwertung der Filmmusik in einem nicht nur auf das Medium Film bezogenen Medienensemble ermöglichen.
Da es sich um eine Übung im Rahmen der Kultur- und Mediengeschichte handelt, wird die historische Entwicklung inkl. auch der Produktionshintergründe der Filme und Serien in den Blick genommen.
Als Beispiele sind u.a. geplant: Casablanca (1942); The Adventures of Robin Hood (Film 1938, TV Serie 1956-1959); L’Ascenseur pour l’échafaud/Fahrstuhl zum Schafott (1958); Spiel mir das Lied vom Tod (1968); The Addams Family (TV Serie 1964); Wednesday (TV Series 2022); Woodstock (1969)
Die Übung ist Teil der ITM-Veranstaltung: "Intermediale Beziehungen: Film, Literatur und Musik", zusammen mit dem Seminar “Medienreflexion in Literatur und Film” von Dr. Claudia Schmitt.
Dr. Barbara Duttenhöfer
Zeit: Fünf Einzeltermine und zwei Blocksitzungen Donnerstags und Freitags (siehe Termine)
Raum: Gebäude B3 1 (siehe Termine)
Dauer: 17.04.2025 bis 01.08.2025
Seit Mitte des 19. Jahrhunderts konnten Frauen als JournalistInnen tätig zu werden. Vor allem in Presseprodukten, die sich speziell an Frauen richteten, haben sie in Berufsblättern für Lehrerinnen, Organen der Frauenbewegung oder Frauen- und Modezeitschriften auch leitende Aufgaben übernommen und waren als Herausgeberinnen, Redakteurinnen, Reporterinnen, Modekolumnistinnen oder Korrespondentinnen tätig. In der sonstigen ‚Männer‘-Presse wurden ihnen dagegen häufig schlechter bezahlte und weniger prominente Arbeitsfelder zugewiesen. Bedeutsam war die Frauenpresse für die Emanzipation in den jeweiligen Epochen und Gesellschaften.
Die mediengeschichtliche Einordnung von Frauenjournalismus ist die Grundlage, um seine medialen Repräsentationen im amerikanischen Kino zu analysieren. Denn wie keine andere Kinolandschaft thematisiert es seit seinen Anfängen die Medien und seine Protagonistinnen und fragt nach ihrem Verhältnis zur „Vierten Gewalt” (Fourth Estate): Diesem Faktor der politischen Kultur kam die Aufgabe zu, mit Kritik und selbständiger Berichterstattung eine Wächterfunktion der Regierung bzw. der politisch Verantwortlichen für die Gesellschaft wahrzunehmen.
In den unterschiedlichen Genres (Komödie, Melodram, Thriller, Western) verbreitet(-e) das amerikanische Kino über den Typ des mutigen Reporters sowohl journalistische Heldengeschichten als auch über den Typ des bestechlichen Journalisten düstere Gegenwartsdiagnosen. Und welche Rollen spiel(t)en hier die Journalistinnen? Wurden sie lediglich als unterstützende Mitarbeiterinnen inszeniert oder als gleichberechtigt und eigenständig agierende JournalistInnen?
Teil 1 der Übung befasst sich mit Frauenjournalismus aus historischer Sicht (und in internationaler Perspektive). Wir entwickeln ein Frageraster (Tätigkeitsfelder, Rollenbilder und Selbstverständnisse) für Teil 2 zur Analyse der Kinofilme aus den 1930 Jahren bis heute.
Folgende Filme werden u.a. analysiert:
- Mr. Smith goes to Washington (Frank Capra 1939)
- His Girl Friday (Howard Hawks 1940)
- Network (Sidney Lumet 1976)
- The Electric Horseman (Sydney Pollack 1979)
- The China Syndrome (James Bridges 1979)
- Absence of Malice (Sydney Pollack 1981)
- The Post (Steven Spielberg 2018)
Termine:
- Donnerstag 17.04., 14-16 Uhr, B 3.1, Raum 2.29
- Freitag 09.05., 14-18 Uhr, B 3.1, Raum 2.17
- Freitag 16.04., 14-18 Uhr, B 3.1, Raum 1.24
- Freitag 13.06., 14-18 Uhr, B 3.1, Raum 2.17
- Freitag 27.06., 14-18 Uhr, B 3.1, Raum 1.30
- Donnerstag 31.07., 10-16 Uhr
- Freitag 01.08., 10-16 Uhr
Julika Badstieber-Waldt, M.A.
Zeit: Mittwochs 08:30 bis 10:00 Uhr
Raum: B4.1, Seminarraum 0.02.1
Dauer: 09.04.2025 bis 16.07.2025
„Paris ist zur offenen Stadt erklärt worden. (…) Während meines gesamten Hin- und Rückweges war Paris völlig verlassen. Das richtige Wort ist: leer“, so beschrieb der Pariser Schriftsteller Paul Léautaud die Stimmung in der französischen Hauptstadt am 13. Juni 1940. „Paris! Frankreich! Dass dieser Traum für mich noch einmal in Erfüllung gehen würde, wer hätte das gedacht!“, schrieb die ankommende deutsche Nachrichtenhelferin Gertrud Woltmann beinahe zeitgleich euphorisch in ihrem ersten Brief an ihre Eltern.
Auch in Brüssel zahlreiche Perspektiven: Der ankommende Generalfeldmarschall Fedor von Bock notierte am 28. Mai 1940 offenbar erstaunt wie beglückt in sein Tagebuch: „Um 10.10 Uhr melde ich Brauchitsch am Telefon, daß der bevollmächtigte belgische General die bedingungslose Kapitulation des Heeres unterschrieben hat (…) In 18 Tagen zwei feindliche Heere geschlagen und gefangen“. Der katholische Erzbischof van Roey dagegen gab dem Gefühl der Brüsseler Bevölkerung Ausdruck, wenn er verkündete: „Und schließlich, seien wir gewiss, dass wir in diesem Moment einem außergewöhnlichen Akt der göttlichen Vorsehung beiwohnen, die ihre Kraft durch enorme Ereignisse zum Ausdruck bringt, gegenüber denen wir uns recht klein fühlen.“
Zur selben Zeit zwei Städte, hunderte Erfahrungen: Das Proseminar macht es sich zur Aufgabe, die Geschichte der beiden Hauptstädte Paris und Brüssel zur Zeit der deutschen Besatzung im Zweiten Weltkrieg aus unterschiedlichen Perspektiven zu beleuchten, diese zu kontrastieren und im Sinne einer transnationalen Besatzungsgeschichte zu kreuzen.
Zu diesem Proseminar findet ein begleitendes Tutorium zur Methodik wissenschaftlichen Arbeitens statt. Bitte beachten Sie, dass die Teilnahme am Tutorium VERPFLICHTEND ist. Dieses findet zweiwöchentlich donnerstags 16:15-17:45 in Gebäude B4 1, Raum 0.02.1 unter der Leitung von Lisa Jost statt.
Einführende Literatur:
- Bernd Wegener: Das deutsche Paris: Der Blick der Besatzer 1940-1944, Paderborn 2019.
- Chantal Kesteloot: Bruxelles sous l'Occupation 1940-1944, Brüssel 2008.
- Karl Schlögel: Im Raume lesen wir die Zeit: Über Zivilisationsgeschichte und Geopolitik, München 2003.
Zeit: Dienstags 14:15 bis 15:45 Uhr
Raum: Gebäude B4 1, Raum 0.02.1
Dauer: 08.04.2025 bis 15.07.2025
In unserer demokratischen Gesellschaft verstehen sich die etablierten Massenmedien als „die vierte Gewalt“. Sie wollen informieren und gleichzeitig kritische Beobachter des Staates und der Gesellschaft sein. Das war nicht immer so: Die Nationalsozialisten machten Medien zu einem zentralen Herrschaftsinstrument. Besonders in Kriegszeiten sollten Rundfunk, Presse und Wochenschau als „Stütze des Regimes“ fungieren. So zumindest die Theorie, denn heute hat die Forschung festgestellt, dass die Mediennutzung und -rezeption spätestens ab 1941 bei Weitem nicht immer der gewünschten Wirkung entsprach. Skepsis und Unzufriedenheit mit dem, was man zu lesen, sehen und hören bekam, waren genauso in der deutschen Bevölkerung vorzufinden wie im besetzten Frankreich. Dort wurde Gegenrede gar zum wichtigsten Mittel des Widerstandes. Es folgte daraus ein permanentes Ringen um Glaubwürdigkeit und die Deutungshoheit.
Die Übung macht es sich zum Ziel, einen Einblick in dieses Spannungsfeld zu vermitteln. Dafür werden Perspektiven zwischen dem deutschen Reich und dem besetzten Frankreich im Sinne einer transnationalen Mediengeschichte des Krieges gekreuzt. Dabei soll nicht zuletzt der Umgang mit unterschiedlichen Quellen wie z.B. Gesetzestexten, Abwehrprotokollen und Tagebüchern eingeübt werden.
Einführende Literatur:
- Clemens Zimmermann: Medien im Nationalsozialismus. Deutschland 1933-1945, Italien 1922-1943, Spanien 1936-1951, Wien u.a. 2007.
- Bernd Heidenreich/Sönke Neitzel (Hrsg.): Medien im Nationalsozialismus, Paderborn 2010.
- Frank Bösch: Mediengeschichte. Vom asiatischen Buchdruck zum Computer, 2. Auflage, Frankfurt/New York 2019.
Mia Berg, M.A.
Zeit: Blocktermine an sechs Freitagen 10:00 bis 14:00/16:00 Uhr
Raum: Gebäude B4 1 - Seminarraum 0.02.1/Online auf MSTeams
Dauer: 11.04.2025 bis 18.07.2025
Mit der zunehmenden Verbreitung von Fake News und Desinformationen in sozialen Medien steigt die Notwendigkeit der kritischen Einordnung und Kontextualisierung von Plattforminhalten – im öffentlichen und wissenschaftlichen Diskurs, aber auch und gerade auf den Plattformen selbst. Auch in Bezug auf Geschichte ist eine Vervielfachung von Inhalten, Akteur*innen und Praktiken zu beobachten, die von oberflächlicher Unterhaltung über Bildungsarbeit bis hin zu Verzerrung und Geschichtsrevisionismus reichen. Diskutiert wird deshalb zunehmend, ob und inwiefern auch Historiker*innen stärker auf den Plattformen aktiv sein müssten – und welche Medien, Formate und Inhalte sich dafür eignen.
Die Übung widmet sich deshalb der Frage, wie Geschichte in sozialen Medien kommuniziert und produziert werden kann. Dafür werden zunächst ausgewählte Beispiele untersucht und mediale und narrative Spezifika sowieso Möglichkeiten und Grenzen der Darstellung in den Blick genommen. Neben der Auseinandersetzung mit populären und unterhaltungshistoriographischen Formaten soll ein dezidierter Fokus darauf gerichtet werden, wie Geschichte als Wissenschaft in sozialen Medien kommuniziert werden kann.
In einer anschließenden Praxisphase erstellen die Studierenden eigene Formate. Die Produktionsphase ist als offener Testraum konzipiert, in dem verschiedene Medien und Tools ausprobiert sowie Formate erprobt werden sollen. Die eigentliche Produktentwicklung findet in Abstimmung mit den Interessen der Teilnehmenden statt.
Einführende Literatur:
Brüning, Christina/Krebs, Alexandra (Hg.): Historisches Erzählen in Digitalien. Theoretische Reflexionen und empirische Beobachtungen, Bielefeld 2024.
Hasselhorn, Benjamin et al. (Hg.): Wege aus dem Elfenbeinturm. Geschichtswissenschaft in den Sozialen Medien, Freiburg im Breisgau 2024.
Steinhauer, Jason: History, Disrupted. How Social Media and the World Wide Web Have Changed the Past, Cham 2022.
TransferUnit Wissenschaftskommunikation: Potenziale und Herausforderungen sozialer Medien für die Wissenschaftskommunikation. Ein Forschungsüberblick, Berlin 2024.
Walden, Victoria Grace/Marrison, Kate: Recommendations for using Social Media for Holocaust Memory and Education.
Bemerkung: Die Veranstaltung ist als Blended-Learning Szenario angelegt, sodass Teile der Übung vor Ort, andere Teile digital über Teams stattfinden. Die Modi der einzelnen Termine werden in der ersten Sitzung gemeinsam mit den Studierenden festgelegt. Neben fünf Blockterminen, jeweils freitags von 10-14 bzw. 16 Uhr, sind auch zwei asynchrone Arbeitsphasen geplant. Notwendig ist deshalb die Bereitschaft, nach Anleitung über längere Zeiträume selbständig zu den Kursinhalten zu arbeiten. Studierende sollten zudem bereit sein, einzelne Social Media und Anwendungen zu testen und diese dafür ggf. auf ihren Endgeräten zu installieren. Etwaige Bedenken werden zu Beginn der Übung thematisiert. Die Termine finden an folgenden Freitagen statt: 11.04., 10-14 Uhr; 25.04., 10-14 Uhr; 02.05., 10-14 Uhr; 06.06., 10-16 Uhr; 27.06., 10-12 Uhr; 18.07., 10-14 Uhr.
Informationen für Studierende

Leitfäden und Richtlinien
Alle wichtigen Informationen zu den Formalia von Seminar-, Bachelor- oder Masterarbeiten finden Sie unter:
Informationen für Studieninteressierte
Historisch orientierte Kulturwissenschaften
Die Koordinationsstelle "Historisch orientierte Kulturwissenschaften" bietet im Rahmen des zweistufigen Bachelor-/Master-Systems drei interdisziplinäre, praxisorientierte und fakultätsübergreifende Studiengänge an:
- BA Historisch orientierte Kulturwissenschaften
- MA Angewandte Kulturwissenschaften
- MA Historisch orientierte Kulturwissenschaften
Mehr Informationen zu den historisch orientierten Kulturwissenschaften