Medien, Politik und Öffentlichkeiten
Praktiken | Kommunikation | Diskurse
Forschungsprojekte

DFG-FNR-Forschungsgruppe Popkult60
Populärkultur transnational. Europa in den langen 1960er Jahren.
Das Projekt Popkult 60 setzt sich zum Ziel, offensichtliche zeitgeschichtliche Desiderate im Bereich transnationaler Populärkultur zu füllen, theoretische Debatten mit empirischen Fallstudien zu unterfüttern und den Mehrwert eines transnationalen Zugriffs gegenüber Einzelländeranalysen nachzuweisen. Geschehen soll dies durch sieben Populärkulturstudien, die allesamt über den nationalen Tellerrand hinausschauen und mehrere Länder, Kulturen und Gesellschaften berücksichtigen. Besonders weitreichende Einsichten lassen die allen Teilprojekten gemeinsame räumliche Rahmung (Westeuropa) und die zeitliche Eingrenzung (die langen 1960er Jahre) sowie die grundsätzlich eng verwobenen Forschungsdesigns erwarten, die potenziellen “Elfenbeinturm”-Gefahren in Verbundprojekten einen Riegel vorschieben, stattdessen eine hochdialogische Arbeitsweise und fast zwangsläufige teilprojektrelevante Synergien erlauben.
Mitwirkende: Prof. Dr. Clemens Zimmermann |Dr. Gunter Mahlerwein | Joana Baumgärtel, M.A. | Elena Germann (Hilfskraft)
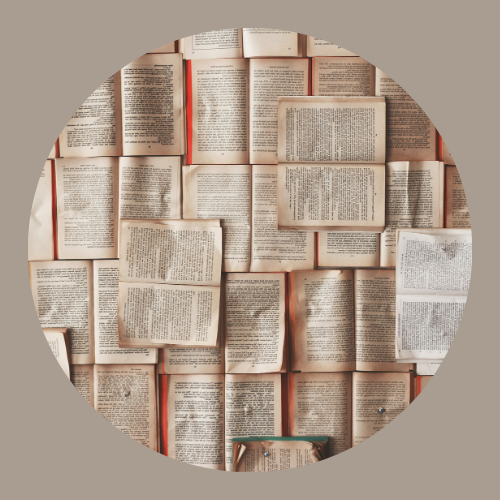
Buchprojekt
Anarchismus. Geschichte einer globalen Bewegung – vom 19. Jahrhundert bis in die Gegenwart
Verlag Reclam | 2025
Anarchist:innen waren aufgrund von Arbeitsmigration und politischem Exil stärker als jede andere soziale und politische Bewegung des 19. und 20. Jahrhunderts mobil, transnational und global vernetzt. Das Buch bietet keine abstrakte Ideengeschichte des Anarchismus, sondern widmet sich den konkreten Praktiken und kommunikativen Netzwerken der anarchistischen Akteur:innen.
Mitwirkende: Prof. Dr. Heinz-Gerhard Haupt |Prof. Dr. Fabian Lemmes
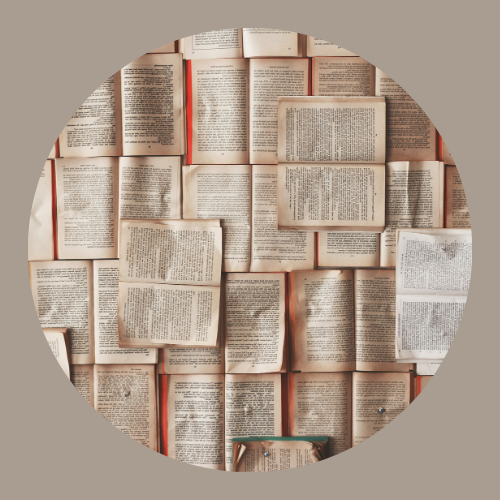
Buchprojekt
Öffentliche Debatten über Terrorismus. Die anarchistischen Attentate in Westeuropa im goldenen Zeitalter der Presse (1878–1906)
Das Buchprojekt analysiert in vergleichender und transnationaler Perspektive den politischen und gesellschaftlichen Umgang mit den anarchistischen Attentaten in Deutschland, Frankreich, Italien und Spanien, die in den Sozialwissenschaften als Prototyp des “modernen” Terrorismus gelten. Es nimmt mit einem kultur- und mediengeschichtlichen Ansatz in den Blick, wie in öffentlichen Debatten die Grenzen legitimer Politik verhandelt und durch Prozesse der Inklusion und Exklusion verschoben sind. Zudem liegt der Fokus auf der Frage, inwieweit diese Debatten transnational und europäisch geprägt sind.
Mitwirkende: Prof. Dr. Fabian Lemmes

Geschichte auf Instagram und TikTok
Das Projekt widmet sich sozialen Medien als Forschungs- und Praxisgegenstand in der Geschichtswissenschaft. Anhand der nutzer:innen- und reichweitenstarken audiovisuellen Plattformen Instagram und TikTok werden vor allem die technischen, rechtlichen und ethischen Rahmenbedingungen wie Herausforderungen einer historischen Social-Media-Forschung in den Blick genommen. Ziel ist eine Reflexion darüber, wie die Kopplung historischer Erzählungen an Datenstrukturen und globale Konzerne historische Forschung und Wissens(re)produktion sich beeinflussen und welche Wege des Umgangs notwendig und möglich sind.
Mitwirkende: Mia Berg, M.A.

Dissertationsprojekt: Die politischen Auswirkungen der Deindustrialisierung. Eine deutsch-französische vergleichende Perspektive
Betreuung: Prof. Dr. Emmanuel Droit | Prof. Dr. Fabian Lemmes
Kontakt:
Raphaël Pernoud, M.A.
Das Forschungsprojekt im Rahmen des DFG-ANR-Projektes DesinEE untersucht fallspezifische Protestbewegungen gegen die Deindustrialisierung seit 1990 in einer deutsch-französischen vergleichenden Perspektive. Für den Vergleich werden zwei Industriestandorte aus dem Chemiesektor herangezogen, die plötzlich ins Rampenlicht der Medien geraten: ein Kaliwerk in Bischofferode (Thüringen) und eine ehemalige Viskosefabrik in Givet (französische Ardennes), die 1993 und 2000 nach heftigen Protesten geschlossen wurden. Die analytischen Schwerpunkte liegen auf der starken Medienberichterstattung der Protestbewegungen und der Strukturierung von Gefühlsgemeinschaften, die mit der Schließung der dortigen Industrie verbunden werden. Ziel ist also, die Erzeugung und Strukturierung von besonderen Emotionen durch die Deindustrialisierung in diesen beiden ländlichen Arbeitergemeinschaften zu hinterfragen, und zwar mithilfe lebensgeschichtlicher Interviews von Zeitzeug:innen und der Analyse medialer Diskurse.

Dissertationsprojekt: Zwischen Arbeits- und Lebenswelt. Sozialpolitik und Wohnungsbau im Bergbau der Saarregion, 1945–1990
Betreuung: Prof. Dr. Fabian Lemmes
Kontakt:
Joana Baumgärtel, M.A.
Das Forschungsprojekt untersucht die siedlungspolitischen Maßnahmen und deren Auswirkungen im Bergbau in der Saarregion von 1945 bis 1990. Ziel ist es, zu verstehen, wie sich nach dem Zweiten Weltkrieg soziale Strukturen entwickelten, wie diese das Leben und Arbeiten der Bergleute beeinflussten und welche Veränderungen sich im Laufe der Zeit ergaben. Ein akteurszentrierter Blick ermöglicht die Untersuchung, wie Staat, Bergbauverwaltung und gesellschaftliche Gruppen zusammenwirkten und wird ergänzt durch eine multiperspektivische Geschichtsschreibung mithilfe lebensgeschichtlicher Interviews von Zeitzeug:innen.
Abgeschlossene Projekte
Studierendenprojekt: Radio? Radio! Seit 100 Jahren und in Zukunft
Betreuung: Prof. Dr. Fabian Lemmes
Im Sommersemester 2023 beschäftigte sich eine Gruppe Studierender der Kultur- und Mediengeschichte mit der Historie des Radios. Mit dem am 29. Oktober 1923 erstmals ausgestrahlten „Unterhaltungsrundfunk", einer Musiksendung des Berliner Vox-Hauses, fand das Radio seinen Anfang als technische Sensation. Seitdem ist das Radio ein den Wandel der Zeit reflektierendes Medium, das sowohl die Hochkultur als auch Massen bedient, aus dem Alltag vieler Menschen nicht mehr wegzudenken. Im Laufe seiner Geschichte erklang es zur Verführung und Aufklärung, formierte Diktatur sowie Demokratie und begleitete sich und die Hörer:innen durch den schnellen Fortschritt der medialen Welt.
Im Rahmen des Jubiläums „100 Jahre Radio in Deutschland" kooperierte Lehrstuhlinhaber Prof. Dr. Fabian Lemmes mit dem leitenden Redakteur des SR2-Kulturradios Thomas Bimesdörfer. Gemeinsam widmeten sie sich zunächst allgemein und später themenspezifisch der Radiogeschichte und bezogen dabei Interessen und Erfahrungen der zwölf Teilnehmenden mit ein. So wurde beispielsweise die Pionierzeit des Radios (1923-1933) in den Blick genommen und auch reflektiert, wie das Radio sich im Verlauf der Zeit als Medium "selbst feiert(e)".
Publikationen (Auswahl)
Julika Badstieber Waldt, »Erbfeinde« - »Erbfreunde« ? Mythen der deutsch-französischen Beziehungen / « Ennemis héréditaires » - « Amis héréditaires » ? Les mythes des relations franco-allemandes », in: Sinnreich, Ursula (Hrsg.): Auf dem Weg in die Zukunft. Die deutsch-französischen Beziehungen 100 Jahre nach dem Ersten Weltkrieg / En route vers l’avenir. Les relations franco-allemandes, 100 ans après la Première Guerre mondiale, Berlin: Hatje Cantz 2020, S. 122-148.
Mia Berg, Participatory memory - historiography - research? Exploring representations of the Holocaust on social media, in: Eva Pfanzelter et al. (Hg.): #Connected Histories. Memories and Narratives of the Holocaust in Digital Space, Berlin/Boston 2024.
Mia Berg, Andrea Lorenz, #HistoryTok - Virale Vergangenheit in Geschichtsdarstellungen auf TikTok, in: Friederike Fischer/Simon Meier-Vieracker/Lisa Niendorf (Hg.): Memefication und Performance. Interdisziplinäre Zugänge zur Videoplattform TikTok, Heidelberg/Berlin 2024.
Mia Berg, Andrea Lorenz, Kristin Oswald, Geschichte auf Instagram und TikTok. Perspektiven auf Quellen und Praktiken, Berlin 2024.
Mia Berg, Christian Kuchler, @ichbinsophiescholl. Darstellung und Diskussion von Geschichte in Social Media, Göttingen 2023.
Amerigo Caruso/Birgit Metzger (Hrsg): Grenzen der Sicherheit. Unfälle, Medien und Politik im deutschen Kaiserreich, Göttingen 2022.
Fabian Lemmes: Der anarchistische Terrorismus des 19. Jahrhunderts und sein soziales Umfeld, in: Stefan Malthaner, Peter Waldmann (Hg.), Radikale Milieus. Das soziale Umfeld terroristischer Gruppen, Frankfurt a.M., Campus, 2012, S. 73-117.
Fabian Lemmes/ Heinz-Gerhard Haupt, Anarchist*innen. Geschichte einer globalen Bewegung - vom 19. Jahrhundert bis in die Gegenwart, Stuttgart, Reclam, ca. 230 S. (in Vorb.).
Birgit Metzger, Umweltbewegung auf dem Land: Revolutionäre Träume und die Normalität ländlicher Initiativen, in: Lu Seegers (Hrsg.): 1968. Gesellschaftliche Nachwirkungen auf dem Lande. Für die Veröffentlichung angenommen, Göttingen 2020, S. 183-210.
Birgit Metzger/Johann Kirchinger (Hrsg.): Themenschwerpunkt Kolonialismus und Landwirtschaft. Zeitschrift für Agrargeschichte und Agrarsoziologie 69. Jg. Heft 2 (2021).
Nachhören. Nachlesen.
Medienbeiträge des Lehrstuhls
|SR kultur: "Mögliche Lehrplanänderung: Saarländische Schüler sollen Gedenkstätte oder KZ besuchen"|
Prof. Dr. Fabian Lemmes sprach am 04.12.2024 als Interviewpartner in der Radiosendung SR kultur mit Sonja Marx über die mögliche Lehrplanänderung zum vorgeschriebenen Besuch von Gedenkstätten für saarländische Schüler:innen.
"Nie wieder ist jetzt" - das ist ein Slogan, der in der letzten Zeit wieder sehr aktuell ist. Doch wie kann man dafür sorgen, dass sich auch die heutigen Schülerinnen und Schüler der Verbrechen des Nationalsozialismus bewusst werden? Eine Maßnahme wird in Zukunft in den saarländischen Lehrplänen stehen: die Schüler und Schülerinnen sollen zumindest einmal in ihrer Schullaufbahn eine Gedenkstätte oder ein KZ besuchen. Dazu im Interview Prof. Fabian Lemmes. Er ist Mitglied der Landesarbeitsgemeinschaft Erinnerungsarbeit im Saarland.
Hören Sie jetzt hier rein!

